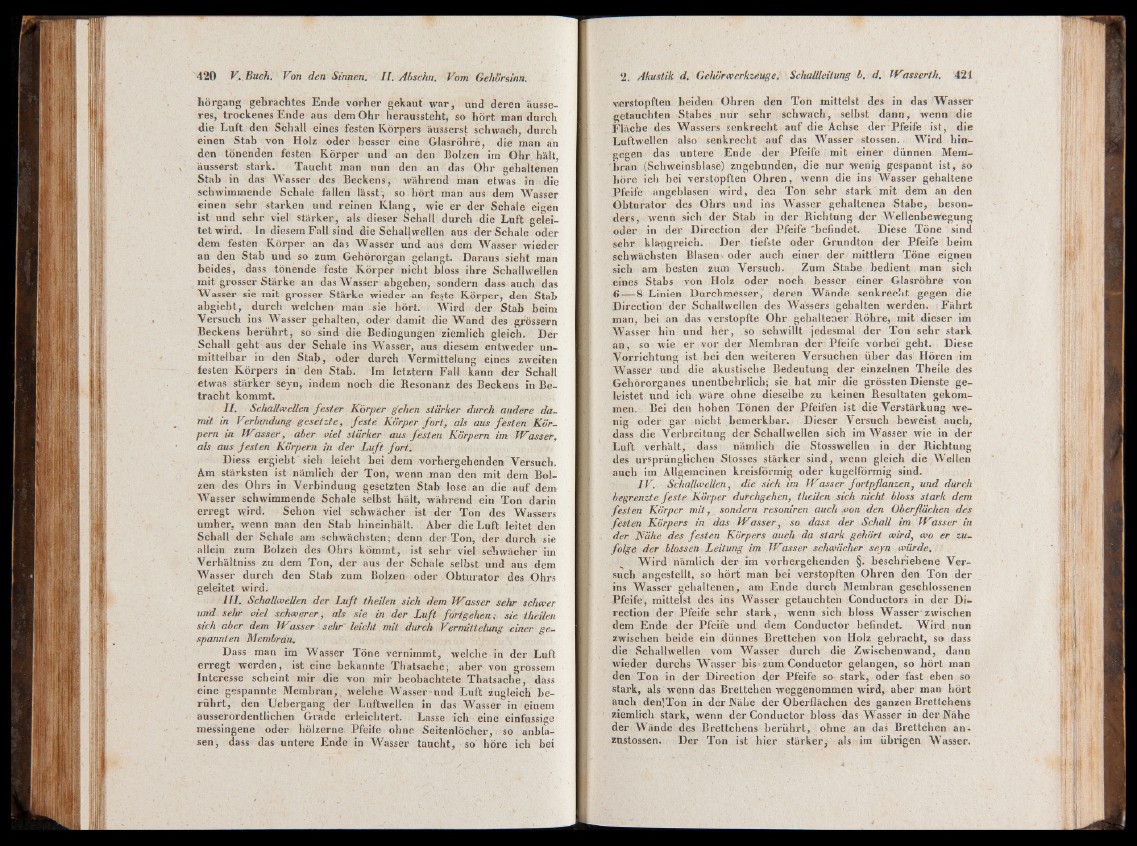
hörgang gebrachtes Ende vorher gekaut war, und deren äusseres,
trockenes Ende aus dem Ohr heraussteht, so hört man durch
die Luft den Schall eines festen Körpers äusserst schwach, durch
einen Stab von Holz oder besser eine Glasröhre, die man an
den tönenden festen Körper und an den Bolzen im Ohr hält,
äusserst stark. Taucht man nun den an das Ohr gehaltenen
Stab in da? W asser . des, Beckens, während man etwas in die
schwimmende Schale fallen lässt', so hört man aus dem Wasser
einen sehr starken und reinen Klang, wie er der Schäle eigen
ist und sehr viel stärker, als dieser Schall durch die Luft geleitetwird.
In diesem Fall sind die Schallwellen aus der Schale oder
dem festen Körper an das Wasser und aus dem Wässer wieder
an den Stab und so zum Gehörorgan gelangt. Daraus sieht man
beides}, dass tönende feste Körper nicht bloss ihre Schallwellen
mit grosser Stärke an das Wasser abgeben, sondern dass auch das
Wasser sie mit grosser Stärke wieder -an feste Körper, den Stab
abgiebt, durch welchen man sie hört. Wifd der Stab beim
Versuch ins Wasser gehalten, oder damit die Wand des gp'össern
Beckens berührt, so sind die Bedingungen ziemlich gleich. Der
Schall geht aus der Schale ins Wasser, aus diesem entweder unmittelbar
in den Stab, oder durch Vermittelung eines zweiten
festen Körpers in den Stab. Im letztem Fall kann der Schall
etwas stärker seyn, indem noch die Besonanz des Beckens in Betracht
kommt.
II. Schallwellen fester Körper gehen stärker durch andere damit
in Verbindung gesetzte,. feste Körper fort, als aus festen Körpern
in Wasser, aber viel stärker aus festen Körpern im Wasser,
als aus festen Körpern in der Luft fort.
Diess ergiebt sich leicht bei dem vorhergehenden Versuch.
Am stärksten ist nämlich der Ton, wenn .man den mit dem Bolzen
des Ohrs in Verbindung gesetzten Stab lose an die aüf dem
Wasser schwimmende Schale selbst hält, während ein Ton darin
erregt wird. Schon viel schwächer ist der Ton des Wassers
umher, wenn man den Stab hineinhält. Aber die Luft leitet den
Schall der Schale am schwächsten; denn der Ton, der durch sie
allein zum Bolzeh des Ohrs kömmt, ist sehr viel schwächer iin
Verhältniss zu dem Ton, der aus der Schale selbst und aus dem
Wasser durch den Stab zum Bolzen oder Obturator des Ohrs
geleitet wird.
III. Schallwellen der Luft theilen sich dem Wasser sehr schwer
und sehr viel schwerer, als sie in der Luft förtgehen; sietheilen
sich aber dem Wasser - sehr' leicht mit durch Vermittelung einer gespannten
Membran.
Dass man im Wasser Töne vernimmt, welche in der Luft
erregt werden, ist eine bekannte Thatsache; aber von grossem
Interesse scheint mir die von mir beobachtete Thatsache, dass
eine gespannte Membran, welche Wasser-und Luft zugleich berührt,
den Uebergang der Luftwellen in das Wasser in einem
ausserordentlichen Grade erleichtert. Lasse ich eine einfussige
messingene oder hölzerne Pfeife ohne Seitenlöcher, so anbla-
sen, dass das untere Ende in Was.ser taucht, so' höre ich bei
verstopften beiden Ohren den Ton mittelst des in das Wasser
getauchten Stabes nur sehr schwach, selbst dann, wenn die
Fläche des Wassers senkrecht auf die Achse derPfeife ist, die
Luftwellen also' senkrecht auf das Wasser stossen. Wird hingegen
das untere Ende der Pfeife j mit einer dünnen Membran
(Schweinsblase) zugebunden, die nur wenig gespannt ist, so
höre ich bei verstopften Ohren, wenn die ins Wasser gehaltene
Pfeife angeblasen wird, den Ton sehr stark mit dem an den
Obturator des Ohrs und ins Wasser gehaltenen Stabe, besonders,
wenn sich der Stab in der Richtung der Wellenbewegung
oder in der Direction der Pfeife 'befindet. Diese Töne sind
sehr klangreich. Der tiefste oder Grundton der Pfeife beim
schwächsten Blasen , oder auch einer der mittlern Töne eignen
sich am besten zum Versuch. Zum Stabe bedient man sich
eines Stabs von Holz oder noch besser einer Glasröhre von
6 — 8 Linien Durchmesser, deren Wände senkrecht gegen die
Direction der Schallwellen des Wassers gehalten werden, j Fährt
man, bei an das verstopfte Ohr gehaltener Röhre, mit dieser im
Wasser hin und her, so schwillt jedesmal der Ton sehr stark
an, so wie er vor der Membran der Pfeife vorbei gebt. Diese
Vorrichtung ist bei den weiteren Versuchen über das’ Hören im
Wasser und die akustische Bedeutung der einzelnen Theile des
Gehörorganes unentbehrlich; sie hat mir die grössten Dienste geleistet
und ich wäre ohne dieselbe zu keinen Resultaten gekommen.
Bei den hohen Tönen der Pfeifen ist die Verstärkung wenig
oder gar nicht bemerkbar. Dieser Versuch beweist auch,
dass die Verbreitung der Schallwellen sich im Wasser wie in der
Luft verhält, dass nämlich die Stossweüen in der Richtung
des ursprünglichen Stosses stärker sind, wenn gleich die Wellen
auch im Allgemeinen kreisförmig oder kugelförmig sind.
IV. Schallwellen, die sich im Wasser fortpflanzen, und durch
begrenzte feste Körper durchgehen, theilen sich nicht bloss stark dem
festen Körper mit, sondern resoniren auch won den Oberflächen des
festen Körpers in das Wasser, so dass der Schall im Wasser'in
der Nähe des festen Körpers auch da stark gehört wird, wo er zufolge
der blossen Leitung im Wasser schwächer seyn würde.
Wird nämlich der im vorhergehenden §. beschriebene Versuch
angestellt, so hört man bei verstopften Ohren den Ton der
ins Wasser gehaltenen, am Ende durch Membran geschlossenen
Pfeife, mittelst des ins Wasser getauchten ;Conductors in der Direction
der Pfeife sehr stark, wenn sich bloss Wasser'zwischen
dem Ende der Pfeife und dem Conductor befindet. Wird nun
zwischen beide ein dünnes Brettchen von Holz gebracht, so dass
die Schallwellen vom Wasser durch die Zwischenwand, dann
wieder durchs Wasser;bis > zum Conductor gelangen, so hört man
den Ton in der Direction der Pfeife so* stark, oder fast eben so
stark, als wenn das Brettchen weggenommen wird, aber man hört
auch den]Ton in der Nähe der Oberflächen des ganzen Brettchens
ziemlich stark, wenn der Conductor bloss das Wasser in der Nähe
der Wände des Brettchens berührt, ohne an da^ Brettchen an-
zustossen. Der Ton ist hier stärker,^ als im übrigen Wasser.