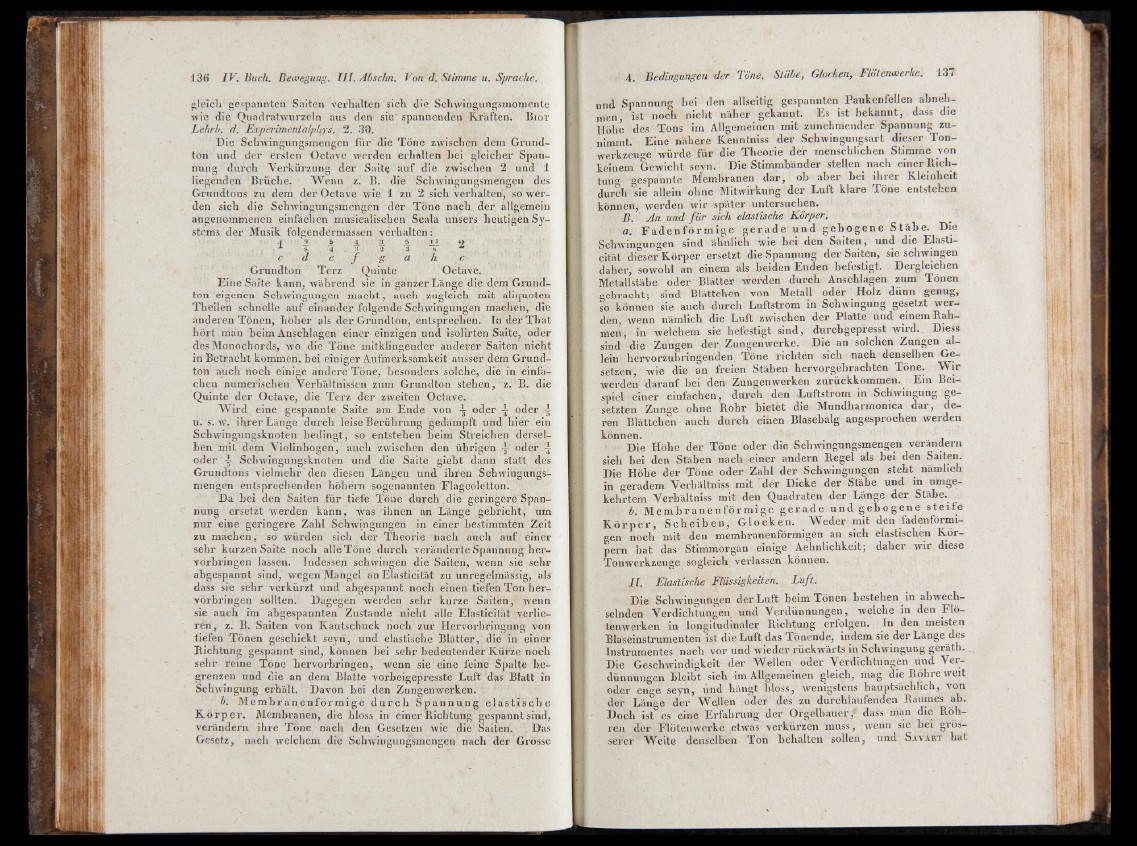
gleich gespannten Saiten verhalten sich die Schwingungsmomente
wie die Quadratwurzeln aus den sie' spannenden Kräften. B iot
L'ehrb, d. Experimentalphys. 2. 30.
Die Schw'ingungsmengen für die Töne zwischen dem Grund-
ton und der ersten Octave werden erhalten hei gleicher Spannung
durch Verkürzung der Saite auf die zwischen 2 und 1
liegenden Brüche. Wenn z. B. die Schwirigungsmengen des
Grundtons zu dem der Octave wie 1 zu 2 sich verhalten, so werden
sich die Schwingungsmengen der Töne nach der allgemein
angenommenen einfachen musicalischen Scala unsers heutigen Systems
der Musik folgen ,1 9 defrr mas4s en v3 erha5 lten: X 4 3 .2 a I 5 gy
c d e f g a h c-
Grundton Terz Quinte Octave.
Eine Saite kann, während sie in ganzer Länge die dem Grundton
eigenen Schwingungen macht, auch zugleich mit aliquoten
Theilen schnelle auf einander folgende Schwingungen machen, di'e
anderen Tönen, höher als der Grundton, entsprechen. InderThat
hört man heim Anschlägen einer einzigen und isolirtön Saite, oder
des Monochords, wo die Töne mitklingender anderer Saiten nicht
in Betracht kommen, bei einiger Aufmerksamkeit ausser dem Grundton
auch noch einige andere Töne, besonders solche, die in einfachen
numerischen Verhältnissen zum Grundton stehen, z. B. die
Quinte der Octave, die Terz der zweiten Octave.
Wird eine gespannte Saite am Ende von y oder y oder y
u. s. w. ihrer Länge durch leise Berührung gedämpft und hier ein
Sehwingungsknoten bedingt, so entstehen heim Streichen derselben
mit dem Violinbogen, auch zwischen den übrigen oder y
oder j Schwingungsknoten und die Saite gieht dann statt des
Grundfons vielmehr den diesen Längen und ihren Schwingungsmengen
entsprechenden höhern sogenannten Flagéoletten.
Da hei den Saiten für tiefe Töne durch’ die geringere Spannung
ersetzt werden kann, was 'ihnen an Länge .gehricht,' um
nur eine geringere Zahl Schwingungen in einer bestimmten Zeit
za machen, so würden sich der Theorie nach auch auf einer
sehr kurzen Saite noch alle Töne durch veränderte Spannung hervorbringen
lassen. Indessen schwingen die Saiten, wenn sie sehr
abgespannt sind, wegen Mangel an Elasticität zu unregelmässig, als
dass sie sehr verkürzt und abgespannt noch einen tiefen Ton hervorbringen
sollten. Dagegen wérden sehr kurze Saiten, wenn
sie auch im abgespannten Zustande nicht alle Elasticität verlieren,
z. B. Saiten von Kautschuck noch' zur Hervorbringung von
tiefen Tönen geschickt seyn, und elastische Blätter, dié in einer
Bichtung gespannt- sind, können bei sehr bedeutender Kürze noch
sehr reine Töne hervorbringen, wenn sie eine feine Spalte begrenzen
und die an dem Blatte vorbeigepresste Luft das Blatt in
Schwingung erhält. Davon bei den Zungenwerken.
b. Membranenförmige d u rc h Spannung e la s tis c h e
K ö rp e r. Membranen, die bloss in einer Richtung gespannt sind,
verändern ihre Töne nach den Gesetzen wie die Saiten. Das
Gesetz, nach welchem die Schwingungsmengen nach der Grösse
und Spannung bei den allseitig gespannten Paukenfellen abnehmen,
ist noch nicht näher gekannt. Es ist bekannt, dass die
Höhe des Tons im Allgemeinen mit zunehmender Spannung zunimmt.
Eine nähere Kenntniss der Schwingungsart dieser Tonwerkzeuge
würde für die Theorie der menschlichen Stimme von
keinem Gewicht seyn. Die Stimmbänder stellen nach einer Richtung
gespannte Membranen dar, ob aber bei ihrer Kleinheit
durch sie allein ohne Mitwirkung der Luft klare Töne entstehen
können, werden wir später untersuchen.
B. An und fü r sich elastische Körper. '
a. F a d e n fö rm ig e g e rad e und gebogene Stäbe. Die
Schwingungen sind ähnlich wie bei den Saiten, und die Eiasti—
cität dieser Körper ersetzt die Spannung der Saiten, sie schwingen
daher, sowohl an einem als beiden Enden befestigt. Dergleichen
Metallstäbe oder Blätter werden durch Anschlägen zum Tönen
gebracht; sind Blättchen von Metall oder Holz dünn genug,
so können sie auch durch Luftstrom in Schwingung gesetzt werden,
wenn nämlich die Luft zwischen der Platte und einem Rahmen,
in welchem sie befestigt sind, durchgepresst wird. Diess
sind dre Zungen der Zungenwerke. Die an solchen Zungen allein
hervorzubringenden. Töne richten sich nach denselben Gesetzen,
wie die an freien Stäben hervorgebrachten Töne. Wir
werden darauf bei den Zungenwerken zurückkommen. Ein Beispiel
einer einfachen, durch den Luftstrom in Schwingung gesetzten
Zunge ohne Rohr bietet die Mundharmomca dar, deren
Blättchen auch durch einen Blasebalg angesprochen werden
können. ,
Die Höhe der Töne oder die Schwingungsmengen verändern
sich bei den Stäben nach einer andern Regel als bei den Saiten.
Die Höhe der Töne oder Zahl der Schwingungen steht nämlich
in geradem Verhältniss mit der Dicke der Stäbe und in umgekehrtem
Verhältniss mit den Quadraten der Länge der Stäbe.
b. M em b ran en fö rm ig e g e ra d e und geb o g en e ste ife
K ö rp e r , S c h e ib e n , Glocken. Weder mit den fadenförim-
gen noch mit den membranenförmigen an sich elastischen Körpern
hat das Stimmorgan einige Aehnlichkeit; daher wir diese
Tonwerkzeuge sogleich verlassen können.
II. Elastische Flüssigkeiten. Luft.
Die Schwingungen der Luft beim Tönen bestehen in abwechselnden
Verdichtungen, und Verdünnungen, welche in den Flötenwerken
in longitudinaler Richtung erfolgen. In den meisten
Blaseinstrumenten ist die Luft das Tönende, indem sie der Länge des
Instrumentes nach vor und wieder rückwärts in Schwingung geräth.
Die Geschwindigkeit der Wellen oder Verdichtungen und Verdünnungen
bleibt sich im Allgemeinen gleich, mag die Röhre weit
oder enge seyn, und hängt bloss, wenigstens hauptsächlich, von
der Länge der Wellen oder des zu durchlaufenden Raumes ab.
Doch ist es eine Erfahrung der Orgelbauer, dass man die Bühren
der Flötenwerke etwas verkürzen muss, wenn sie bei grösserer
Weite denselben Ton behalten sollen, und S avart hat