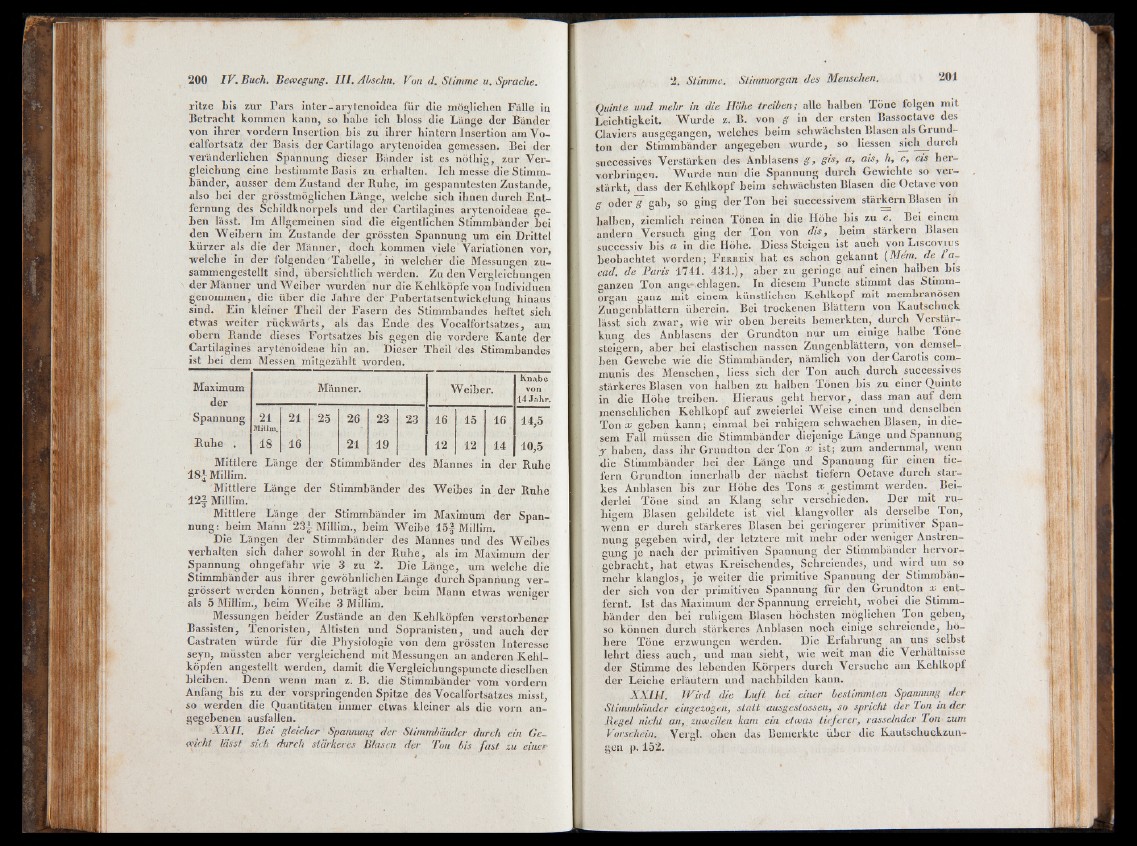
ritze bis zur Pars inter-arytenoidea für die möglichen Fälle in
Betracht kommen kann, so habe ich bloss die Länge der Bänder
von ihrer vordem Insertion bis zu ihrer hintern Insertion am Vo-
calfortsatz der Basis, der Cartilago arytenoidea gemessen. Bei der
veränderlichen Spannung dieser Bänder ist es nöthig, zur Vergleichung
eine bestimmte Basis zu erhalten. Ich messe die Stimmbänder,
ausser dem Zustand der Ruhe, im gespanntesten Zustande,
also bei der grösstmöglichen Länge, welche sich ihnen durch Entfernung
des Schildknorpels und der Cartilagines arytenoideae geben
lässt. Im Allgemeinen sind die eigentlichen Stimmbänder bei
den Weibern im Zustande der grössten Spannung um ein Drittel
kürzer als die der Männer, doch kommen viele Variationen vor,
welche in der folgenden'Tabelle, in welcher die Messungen zusammengestellt
sind, übersichtlich werden. Zu den Vergleichungen
der Männer und Weiher wurden nur die Kehlköpfe von Individuen
genommen, die über die Jahre der Pubertätsentwickelung hinaus
sind. Ein kleiner Theil der Fasern des Stimmhandes heftet sich
etwas weiter rückwärts, als das Ende des Vocalfortsatzes, am
obern Rande dieses Fortsatzes bis gegen die vordere Kante der
Cartilagines arytenoideae hin an. Dieser Theil des Stimmbandes
ist bei dem Messen mitgezählt worden.
Maximum
der
Spannung
. Männer. Weiber.
Knabe
von
14 Jahr.
21
Millm.
21 25 26 23 23 16 15 16 14,5
Ruhe ; 18 16 21 19 12 12 14 10,5
Mittlere Länge der Stimmbänder des Mannes in der Ruhe
18L Millim.
Mittlere Länge der Stimmbänder des Weibes in der Ruhe
12-j Millim.
Mittlere Länge der Stimmbänder im Maximum der Spannung:
beim Mann 23A Millim., beim Weihe 15f Millim.
Die Längen der Stimmbänder des Mannes und des Weihes
verhalten sich daher sowohl in der Ruhe, als im Maximum der
Spannung ohngefähr wie 3 zu 2. Die Länge, um welche die
Stimmbänder aus ihrer gewöhnlichen Länge durch Spanüung ver-
grössert werden können, beträgt aber beim Mann etwas weniger
als 5 Millim., beim Weibe 3 Millim.
Messungen beider Zustände an den Kehlköpfen verstorbener
Bassisten, Tenoristen, Altisten und Sopranisten, und auch der
Castraten würde für die Physiologie von dem grössten Interesse
seyn, müssten aber vergleichend mit Messungen an anderen Kehlköpfen
angestellt werden, damit die Vergleichungspuncte dieselben
bleiben. Denn wenn man z. B. die Stimmbänder vom vordem
Anfang bis zu der vorspringenden Spitze des Vocalfortsatzes misst,
so werden die Quantitäten immer etwas kleiner als die vorn angegebenen
ausfallen.
XXII. Bei gleicher Spannung der Stimmbänder durch ein Gewicht
lässt sich durch stärkeres Blasen der Ton bis fast zu einer
Quinte und mehr in die Höhe treiben; alle halben Töne folgen mit
Leichtigkeit. Wurde z. B. von g in der ersten Bassoctave des
Claviers ausgegangen, welches beim schwächsten Blasen als Grund-
ton der Stimmbänder angegeben wurde, so Hessen sich durch
successives Verstärken des Anblasens g , gis, a, ais, h, c, cis hervorbringen.
Wurde nun die Spannung durch Gewichte so verstärkt,
dass der Kehlkopf beim schwächsten Blasen die Octave von
g oder g7 gab, so ging der Ton bei successivem stärkern Blasen in
halben, ziemlich reinen Tönen in die Höhe bis zu e. Bei einem
andern Versuch ging der T°n von d i s , beim stärkern Blasen
successiv bis a in die Höhe. Diess Steigen ist auch von Liscovius
beobachtet worden; F e rhein hat es schon gekannt (M em . d e l a -
ca d . d e P a r is 1741. 431.), aber zu geringe auf einen halben bis
ganzen Ton angtr.chlagen. In diesem Puncte stimmt das Stimmorgan
ganz mit einem künstlichen Kehlkopf mit membranösen
Zungenblättern überein. Bei trockenen Blättern von Kautschuck
lässt sich zwar, wie wir oben bereits bemerkten, durch Verstärkung
des Anblasens der Grundton nur um einige halbe Töne
steigern, aber bei elastischen nassen Zungenblättern, von demselben
Gewebe wie die Stimmbänder, nämlich von der Carotis communis
des Menschen, liess sich der Ton auch durch successives
stärkeres Blasen von halben zu halben Tönen bis zu einer Quinte
in die Höhe treiben. Hieraus geht hervor, dass man auf dem
menschlichen Kehlkopf auf zweierlei Weise einen und denselben
Ton x geben kann; einmal hei ruhigem schwachen Blasen, in diesem
Fall müssen die Stimmbänder diejenige Länge und Spannung
y haben, dass ihr Grundton der Ton x ist; zum andernmal, wenn
die Stimmbänder hei der Länge und Spannung für einen tie-
fern Grundton innerhalb der nächst tiefem Octave durch starkes
Anblasen bis zur Höhe des Tons x gestimmt werden. Beiderlei
Töne sind an Klang sehr verschieden. Der mit ruhigem
Blasen gebildete ist viel klangvoller als derselbe Ton,
wenn er durch stärkeres Blasen hei geringerer primitiver Spannung
gegeben wird, der letztere mit mehr oder weniger Anstrengung
je nach der primitiven Spannung der Stimmbänder hervorgebracht,
hat etwas Kreischendes, Schreiendes, und wird um so
mehr klanglos, je weiter die primitive Spannung der Stimmbänder
sich von der primitiven Spannung für den Grundton entfernt.
Ist das Maximum der Spannung erreicht, wobei die Stimmbänder
den bei ruhigem Blasen höchsten möglichen Ton geben,
so können durch stärkeres Anblasen noch einige schreiende, höhere
Töne erzwungen werden. Die Erfahrung an uns selbst
lehrt diess auch, und man sieht, wie weit man die Verhältnisse^
der Stimme des lebenden Körpers durch Versuche am Kehlkopf
der Leiche erläutern und nachbilden kann.
XXIII. Wird die Luft bei einer bestimmten Spannung der
Stimmbänder eingezogen, statt ausgestossen, so spricht der Ton in der
Regel nicht an, zuweilen kam ein etwas tieferer, rasselnder Ton zum
Vorschein. Vergl. oben das Bemerkte über die Kautscheckzungen
p. 152.