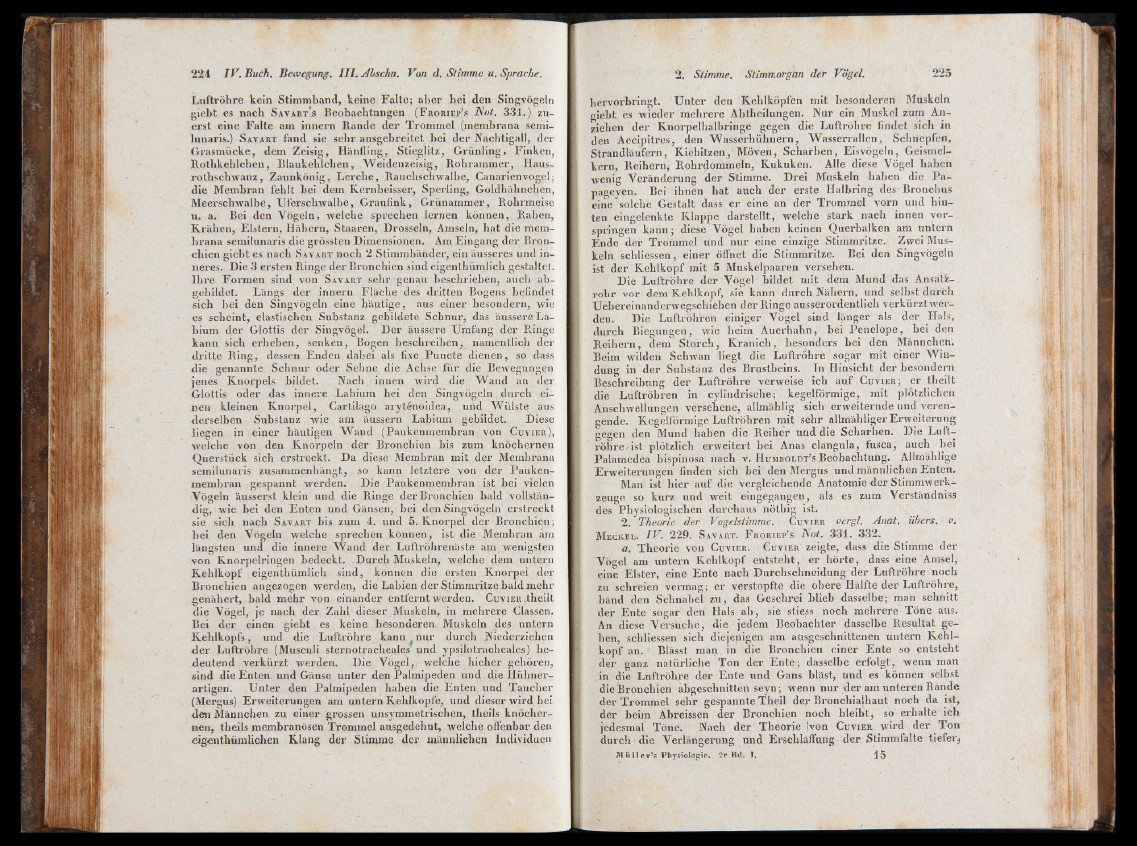
Luftröhre kein Stimmband, keine Falte; aber bei den Singvögeln
giebt es nach S avart js Beobachtungen (F roriep’s Not. 331.) zuerst
eine Falte am innern Rande der Trommel (membrana semi-
lunaris.) S avakt fand sie sehr ausgebreitet bei der Nachtigall, der
Grasmücke, dem Zeisig, Hänfling, Stieglitz, Grünling, Finken,
Rothkehlchen, Blaukehlchen, Weidenzeisig, Rohrammer, Haus-
rothschwanz, Zaunkönig, Lerche, Rauchschwalbe, Canarienvogel;
die Membran fehlt hei dem Kernbeisser, Sperling, Goldhähnchen,
Meerschwalbe, Uferschwalbe, Graufink, Grünammer, Rohrmeise
u. a. Bei den Vögeln, welche sprechen lernen können, Raben,
Krähen, Elstern, Hähern, Staaren, Drosseln, Amseln, hat die rüem-
brana semilunaris die grössten Dimensionen. Am Eingang der Bronchien
gieht es nach S avart noch 2 Stimmbänder, ein äusseres und inneres.
Die 3 ersten Ringe der Bronchien sind eigenthümlich gestaltet.
Ihre Formen sind von S avart sehr genau beschrieben, aueb abgebildet.
Längs der innern Fläche des dritten Bogens befindet
sich bei den Singvögeln eine häutige, aus einer besondern, wie
es scheint, elastischen Substanz gebildete Schnur, das äussere La-
bium der Glottis der Singvögel. Der äussere Umfang der Ringe
kann sich erheben, senken, Bogen beschreiben, namentlich der
dritte Ring, dessen Enden dabei als fixe Puncte dienen, so dass
die genannte Schnur oder Sehne die Achse für die Bewegungen
jenes Knorpels bildet. Nach innen wird die Wand an der
Glottis oder das innere Labium bei den Singvögeln. durch einen
kleinen Knorpel, Cartilago arytönoidea, uüd Wülste aus
derselben Substanz wie am äussern Labium gebildet. Diese
liegen in einer häutigen Wand (Paukenmembran von Cuvier),
welche von den Knorpeln der Bronchien bis zum knöchernen
Querstück sich erstreckt. Da diese Membran mit der Membrana
semilunaris zusammenhängt, so kann letztere von der Paukenmembran
gespannt werden. Die Paukenmembran ist bei vielen
Vögeln äusserst klein und die Ringe der Bronchien bald vollständig,
wie bei den Enten und Gänsen, bei den Singvögeln erstreckt
sie sich nach S avart bis zum 4. und 5. Knorpel der Bronchien ;
bei den Vögeln welche sprechen können, ist die Membran am
längsten und die innere'Wand der Luftröhrenäste am wenigsten
von Knorpelringen bedeckt. Durch Muskeln, welche dem untern
Kehlkopf eigenthümlich sind, können die ersten Knorpei der
Bronchien angezogen werden, die Labien der Stimmritze bald mehr
genähert, hald mehr von einander entfernt werden. Cuvier .theilt
die Vögel, je nach der Zahl dieser Muskeln, in mehrere Classen.
Bei der einen gieht es keine besonderen, Muskeln des untern
Kehlkopfs, und die Luftröhre kann nur durch Niederziehen
der Luftröhre (Musculi sternotracheales und ypsilotracheales j bedeutend
verkürzt werden. Die Vögel, welche hieher gehören,
sind die Enten, und Gänse unter den Palmipeden und die Hühner-
artigen. Unter den Palmipeden haben die Enten, und Taucher
(Mergus) Erweiterungen am untern Kehlkopfe, und dieser wird bei
den Männchen zu einer grossen unsymmetrischen, theils knöchernen,
theils membranösen Trommel ausgedehnt, welche offenbar den
eJgenthümlichen Klang der Stimme der männlichen Individuen
hervorhringt. Unter den Kehlköpfen mit besonderen Muskeln
giebt, es wieder mehrere Abtheilungen. Nur ein Muskel zum Anziehen
der Knorpelhalbringe gegen die Luftröhre findet sich in
den Accipitres, den Wasserhühnern, Wasserrallen, Schnepfen,
Strandläufern, Kiebitzen, Möven, Scharben, Eisvögeln, Geismelkern,
Reihern; Rohrdommeln, Kukuken. Alle diese Vögel haben
wenig Veränderung der Stimme. Drei Muskeln haben die Papageyen.
Bei ihnen hat auch der erste Halbring des Bronchus
eine solche Gestalt dass er eine an der Trommel vorn und hinten
eingelenkte Klappe därstellt, welche stark nach inneu vor-
springen kann; diese Vögel haben keinen Querbalken arU untern
Ende der Trommel und nur eine einzige Stimmritze. Zwei Muskeln
schliessen, einer öffnet die Stimmritze. Bei den Singvögeln
ist der Kehlkopf mit 5 Muskelpaaren versehen.
Die Luftröhre der Vögel bildet mit Hem Mund das Ansatfc-
rohr vor dem Kehlkopf, sie kann durch Nähern, und selbst durch
Uebereinanderwegschieben der Ringe ausserordentlich verkürzt werden.
Die Luftröhren einiger Vögel sind länger als der Hals,
durch Biegungen, wie beim Auerhahn, bei Penelope, bei den
Reihern, dem Storch, Kranich, besonders bei den Männcheni
Beim wilden Schwan liegt die Luftröhre sogar mit einer Windung
in der Substanz des Brustbeins. In Hinsicht der besonderrt
Beschreibung der Luftröhre verweise ich auf Cuvier; er theilt
die Luftröhren in cylindrische; kegelförmige, mit plötzlichen
Anschwellungen versehene, allmählig sich erweiternde und verengende.
Kegelförmige Luftröhren mit sehr allmähliger Erweiterung
gegen den Mund haben die Reiher und die Scharben. Die Luftröhre
ist plötzlich erweitert bei Anas clangula, fusca, auch bet
Palamedea bispinosa nach y . Humboldt’s Beobachtung. Allmählige
Erweiterungen finden sich bei den Mergus und männlichen Enten.
Man ist hier auf die vergleichende Anatomie der Stimmwerkzeuge
so kurz und weit eingegangen, als es zum Verständniss
des Physiologischen durchaus nöthig ist.
2. Theorie der Vogelstimme. Cuvier ocrgl. Anat. übers, v.
Meckei.. IV. 229. Savart. F roriep’s Not. 331. 332.
a. Theorie von Cuvier. Cuvier zeigte, dass die Stimme der
Vögel am untern Kehlkopf entsteht, er hörte, dass eine Amsel,
eine Elster, eine Ente nach Durchschneidung der Luftröhre noch
zu schreien vermag; er verstopfte die obere Hälfte der Luftröhre,
band den Schnabel zu, das Geschrei blieb dasselbe; man schnitt
der Ente sogar den Hals ab, sie stiess noch mehrere Töne aus.
An diese Versuche, die jedem Beobachter dasselbe Resultat geben,
schliessen sich diejenigen am ausgeschnittenen untern Kehlköpf
an. Blässt man in die Bronchien einer Ente so entsteht
der ganz natürliche Ton der Ente; dasselbe erfolgt, wenn man
in die Luftröhre der Ente und Gans bläst, Und es können selbst
die Bronchien abgeschnitten seyn; wenn nur der am unteren Rande
der Trommel sehr gespannte Theil der Bronchialhaut noch da ist,
der beim Äbreissen der Bronchien noch bleibt, so erhalte ich
jedesmal Töne. Nach der Theorie Jvon Cuvier tvird der Ton
durch die Verlängerung und Erschlaffung der Stimmfalte tiefer,
M »i 11 e r’s Physiologie. 2r Bd. I. 15