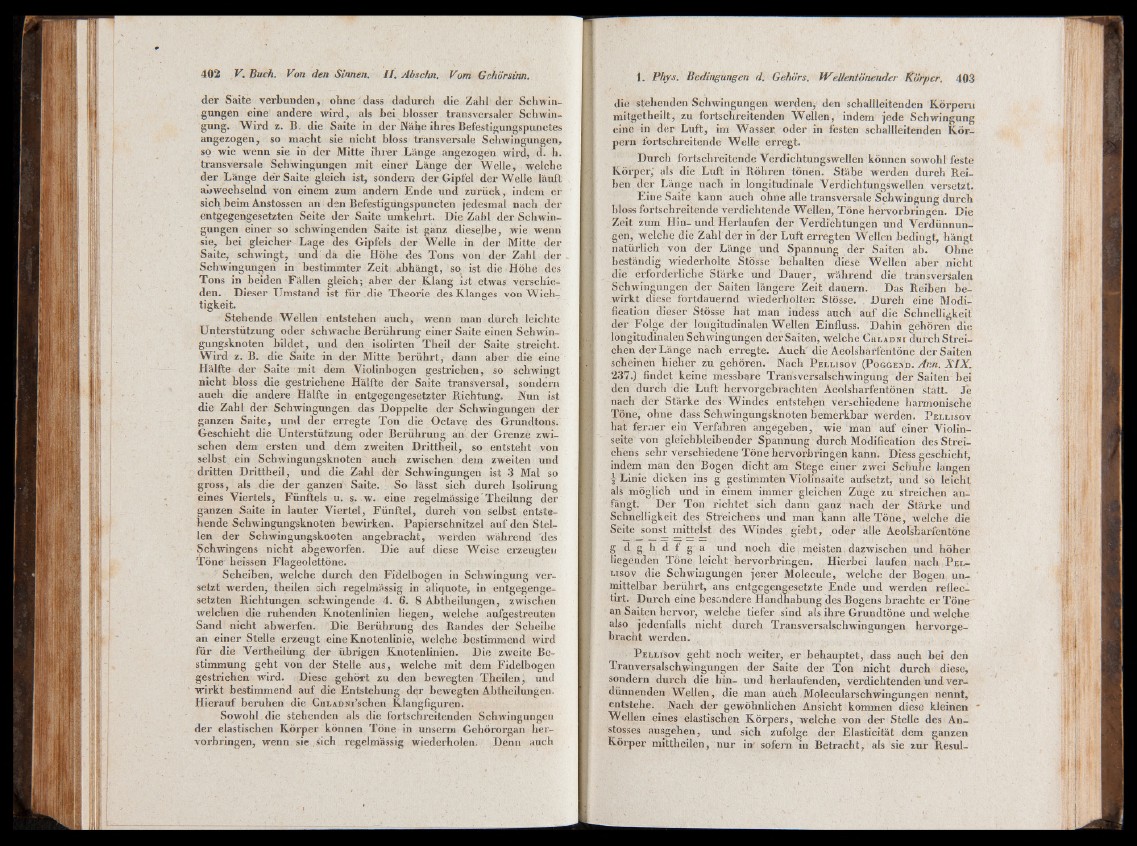
der Saite verbunden, ohne dass dadurch die Zahl der Schwingungen
eine andere wird, als bei blosser transversaler Schwingung.
Wird z. B. die Saite in der Nähe ihres Befestigungspunctes
angezogen, so macht sie nicht bloss transversale Schwingungen,
so wie wenn sie in der Mitte ihrer Länge angezogen wird, d. h.
transversale Schwingungen mit einer Länge der Welle, welche
der Länge der Saite gleich ist, sondern der Gipfel der Welle läuft
abwechselnd von einem zum andern Ende und zurück, indem er
sich beim Anstossen an den Befestigungspuncten jedesmal nach der
entgegengesetzten Seite der Saite umkehrt. Die Zahl der Schwingungen
einer so schwingenden Saite ist ganz dieselbe, wie wenn
sie, bei gleicher Lage des Gipfels der Welle in der Mitte der
Saite, schwingt, und da die Höhe des Tons von der Zahl der
Schwingungen in bestimmter Zeit abhängt, so ist die Höhe des
Tons in beiden Fällen gleich; aber der Klang ist etwas verschieden.
Dieser Umstand ist für die Theorie des Klanges v;on Wichtigkeit.
Stehende Wellen entstehen auch,.; wenn man durch leichte
Unterstützung oder Schwache Berührung einer Saite einen Schwingungsknoten
bildet, und den isolirten Theil der Saite streicht.
Wird z. B. die Saite in der Mitte berührt, dann aber die eine'
Hälfte der Saite mit dem Violinbogen gestrichen, so schwingt
nicht bloss die gestrichene Hälfte der Saite transversal, sondern
auch die andere Hälfte in entgegengesetzter Richtung. Nun ist
die Zahl der Schwingungen, das Doppelte der Schwingungen der
ganzen Saite, und der erregte Ton die Octave des Grundtons.
Geschieht die Unterstützung oder Berührung an, der Grenze zwischen
dem ersten und dem zweiten Drittheil, so entstellt von
selbst ein Schwingungsknoten auch zwischen dem zweiten und
dritten Drittheil, und die Zahl der Schwingungen ist 3 Mal so
gross, als die der ganzen Saite. So lässt sich durch Isolirung
eines Viertels, Fünftels u. s* w. eine regelmässige Theilung der
ganzen Saite in lauter Viertel, Fünfte}, durch von selbst entstehende
Schwingungsknoten bewirken. Papierschnitzel auf den Stellen
der Schwingungsknoten angebracht, werden während des
Schwingens nicht abgeworfen. Die auf diese Weise erzeugten
Töne' heissen Flageolettöne.
Scheiben, welche durch den Fidelbogen in Schwingung versetzt
werden, theilen sich regelmässig in aliquote, in entgegengesetzten
Richtungen schwingende 4. 6. 8 Abtheilungen, zwischen
welchen die ruhenden Knotenlinien liegen, welche aufgestreuten
Sand nicht abwerfen. Die Berührung des Randes der Scheibe
an einer Stelle erzeugt eine Knotenlinie, Welche bestimmend wird
für die Vertheilüng der übrigen Knotenlinien. Die zweite Bestimmung
geht von der Stelle aus, welche mit dem Fidelbogen
gestrichen wird. Diese gehört zu den bewegten Theilen j und
wirkt bestimmend auf die Entstehung der bewegten Abtheilungen.
Hierauf beruhen die CnLADNi’schen Klangfiguren.
Sowohl, die stehenden als die fortschreitenden Schwingungen
der elastischen Körper können Töne in unserm Gehörorgan hervorbringen,
wenn sie,sich regelmässig wiederholen. Denn auch
die stehenden Schwingungen werden^ den schallleitenden Körpern
mitgetheilt, zu fortschreitenden Wellen, indem jede Schwingung
eine in der Luft, im Wasser, oder in festen schallleitenden Körpern
fortschreitende Welle erregt.
Durch fortschreitende Verdichtungswellen können sowohl feste
Körper,' als die Luft in Röhren tönen. Stäbe werden durch Reiben
der Länge nach in longitudinale Verdichtungswellen versetzt.
Eine Saite kann auch ohne alle transversale Schwingung durch
I bloss fortschreitende verdichtende Wellen, Töne hervorhringen. Die
Zeit zum Hin-und Herlaufen der Verdichtungen und Verdünnungen,
welche die Zahl der in'der Luft erregten Wellen bedingt, hängt
9 natürlich von der Länge und Spannung der Saiten ab. Ohne
beständig wiederholte Stösse behalten die§è Wellen aber nicht
die erforderliche Stärke und Dauer, während die transversalen
Schwingungen der Saiten längere Zeit dauern. Das Reiben bewirkt
diese fortdauernd wiederholten Stösse. Durch eine Modification
dieser Stösse hat man indess auch auf die Schnelligkeit
der Folge der longitudinalen Wellen Einfluss. Dahin gehören die
longitudinalen Schwingungen der Saiten, welche Chladni durch Streichen
der Länge nach erregte. Auch' die Aeolsharfentöne der Saiten
■ scheinen hieher zu gehören. Nach P ellisov (Poggend. Ann. X IX r
237.). findet keine messbare Trarisversalschwingung der Saiten'bei
den durch die Luft hervorgebrachten Aeolsharfentönen statt. Je
nach der Stärke des Windes entstehen verschiedene harmonische
Töne, ohne dass Schwingungsknoten bemerkbar werden. P ellisov
hat ferner ein Verfahren angegeben, wie man auf einer Violin-
seite von gleichbleibender Spannung durch Modification des Streichens
sehr verschiedene Töne hervorbringen kann. Diess geschieht,
indem man den Bogen dicht am Stege einer zWei Schuhe langen
Linie dicken ins g gestimmten Violinsaite aufsetzt, und so leicht
als möglich und in einem immer gleichen Zuge zu streichen anfängt.
Der Ton richtet sich dann ganz nach der Stärke und
Schnelligkeit des Streichens und man kann alle Töne, welche die
Seite sonst mittelst des Windes giebt, oder allé Aeolsharfentöne
g d g h d f g ä und noch, die. meisten, dazwischen und höher
liegenden Tone leicht hervorbringen. Hierbei laufen nach P ellisov
die Schwingungen jener Molecule, welche der Bogen unmittelbar
berührt, ans entgegengesetzte Ende und werden réfléchit.
Durch eine besondere Handhabung des Bogens brachte er Töne^
an Saiten hervor, welche tiefer sind als ihre Grundtöne und welche
also jedenfalls nicht durch Transversalschwingungen hervorgebracht
werden.
P elliso-v geht noch weiter, er behauptet, dass auch bei den
Tranve^salschwingungen der Saite der Ton nicht durch diese,
sondern durch die hin- und herlaufenden, verdichtenden und verdünnenden
Wellen, die man auch Molecularschwingungen nennt,
entstehe. Nach der gewöhnlichen Ansicht kommen diese kleinen
Wellen eines elastischen Körpers, welche von der Stelle des An-
stosses ausgehen, und sich zufolge der Elasticität dem ganzen
Körper mittheilen, nur in' sofern in Betracht, als sie zur Resul