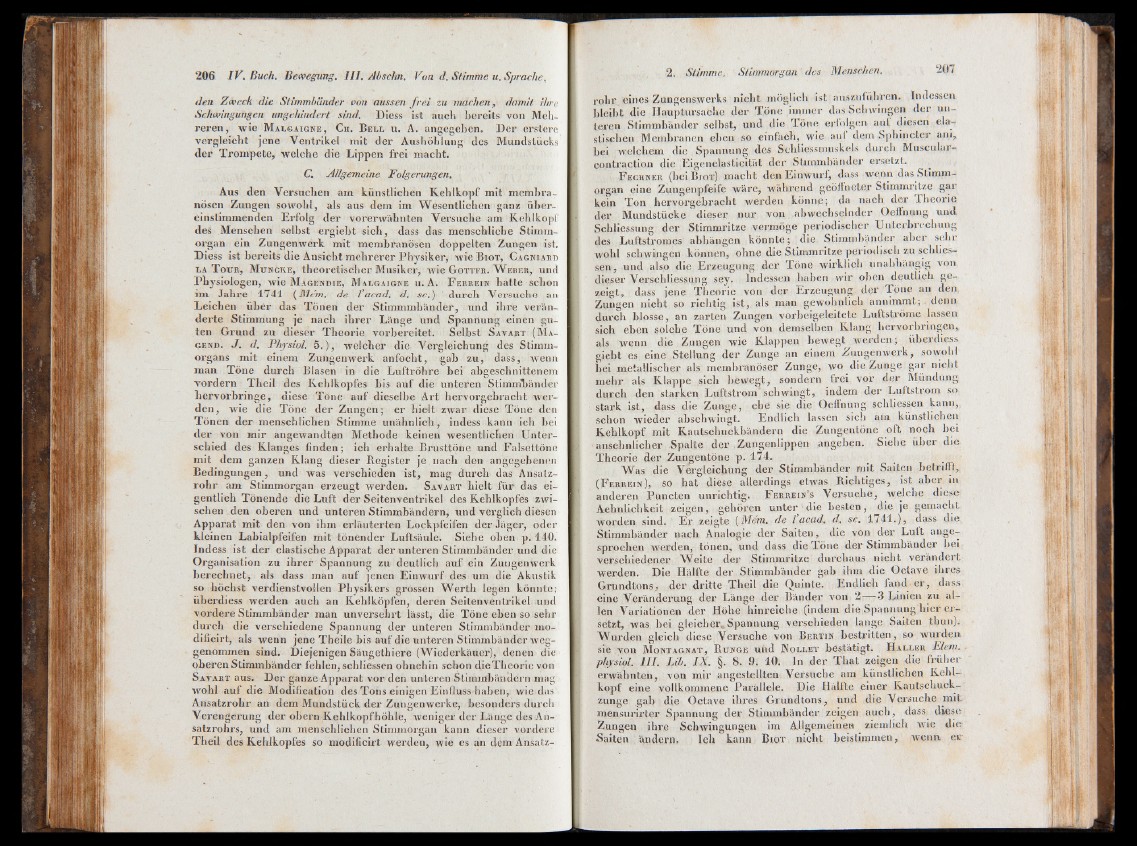
den Zweck die Stimmbänder von aussen fre i zu machen, damit ihre
Schwingungen ungehindert sind. Diess ist auch bereits von Mehreren,
wie Malgaigne, Ch. Bell u . A. angegeben. Der erstere
vergleicht jene Ventrikel mit der Aushöhlung des Mundstücks
der Trompete, welche die Lippen frei macht.
C. Allgemeine Folgerungen.
Aus den Versuchen am künstlichen Kehlkopf mit membra-
nösen Zungen sowohl, als aus dem im Wesentlichen ganz übereinstimmenden
Erfolg der vorerwähnten Versuche am Kehlkopf
des Menschen selbst ergiebt sich, dass das menschliche Stimmorgan
ein Zungenwerk mit membranösen doppelten Zungen ist.
Diess ist bereits die Ansicht mehrerer Physiker, wie B iot, Cagniard
l a T our, Muncke, theoretischer Musiker, wie Gottfr. W eber, und
Physiologen, wie Magendie, Malgaigne u. A. F eerein hatte schon
im Jahre 1741 (Mem. de 1’acad. d. sc.) ' durch Versuche an
Leichen über das Tönen der Stimmmbänder, und ihre veränderte
Stimmung je nach ihrer Länge und Spannung einen guten
Grund zu dieser Theorie vorbereitet. Selbst S avart (Ma-
gend. J. d. Physiol. 5.), welcher die Vergleichung des Stimmorgans
mit einem Zungenwerk anfocht, gab zu, dass, wenn
man Töne durch Blasen in die Luftröhre bei abgeschnittenem
vordem Theil des Kehlkopfes bis auf die unteren Stimmbänder
hervorbringe, diese Töne auf dieselbe Art hervorgebracht werden,
wie die Töne der Zungen; er hielt zwar diese Töne den
Tönen der menschlichen Stimme unähnlich, indess kann ich bei
der von mir angewandten Methode keinen wesentlichen Unterschied
des Klanges finden; ich erhalte Brusttöne und Falsettöne
mit dem ganzen Klang dieser Register je , nach den angegebenen
Bedingungen, und was verschieden ist, mag durch das Ansatz-
rohr am Stimmorgan erzeugt werden. S avart hielt für das eigentlich
Tönende die Luft der Seitenventrikel des Kehlkopfes zwischen
den oberen und unteren Stimmbändern, und verglich diesen
Apparat mit den von ihm erläuterten Lockpfeifen der Jäger, oder
kleinen Labialpfeifen mit tönender Luftsäule. Siehe oben p. 140.
Indess ist der elastische Apparat der unteren Stimmbänder und die
Or ganisation zu ihrer Spannung zu deutlich auf ein Zuugenwerk
berechnet, als dass man auf jenen Einwurf des um die Akustik
so höchst verdienstvollen Physikers grossen Werth legen könnte;
überdiess werden auch an Kehlköpfen, deren Seitenventrikel und
vordere Stimmbänder man unversehrt lässt, die Töne eben so sehr
durch die verschiedene Spannung der unteren Stimmbänder rno-
dificirt, als wenn jene Theile bis auf die unteren Stimmbänder weggenommen
sind. Diejenigen Säugethiere (Wiederkäuer), denen die
oberen Stimmbänder fehlen, schliessen ohnehin schon die Theorie von
S avart aus. Der ganze Apparat vor den unteren Stimmbändern mag
wohl auf die Modification des Tons einigen Einfluss haben, wiedas
Ansatzrohr an dem Mundstück der Zungenwerke, besonders durch
Verengerung der obern Kehlkopf höhle, weniger der Länge des Ansatzrohrs,
und am menschlichen Stimmorgan kann dieser vordere
Theil des Kehlkopfes so modificirt werden, wie es an dem Ansatzrohr
eines Zungenswerks nicht möglich ist auszuführen. Indessen
bleibt die Hauptursachc der Töne immer das Schwingen der unteren
Stimmbänder selbst, und die Töne erfolgen auf diesen elastischen
Membranen eben so einfach, wie auf dem Sphincter ani,
bei welchem die Spannung des Schiiessmuskels durch Muscular-
contraction die Eigenelasticität der Stimmbänder ersetzt.
R echner (bei Biot) macht den Einwurf, dass wenn das Stimmorgan
eine Zungenpfeife wäre, während geölfneter Stimmritze gar
kein Ton hervorgebracht werden könne; da nach der Theorie
der Mundstücke dieser nur von abwechselnder OefFnung und
Schliessung der Stimmritze vermöge periodischer Unterbrechung
des Luftstromes abhängen könnte; die Stimmbänder aber sehr
wohl schwingen können, ohne die Stimmritze periodisch zu schliessen,
und also die Erzeugung der Töne wirklich unabhängig von
dieser Verschliessung sey. Indessen haben wir oben deutlich gezeigt,
dass jene Theorie von der Erzeugung der Töne an den
Zungen nicht so richtig ist, als man gewöhnlich an nimmt; denn
durch blosse, an zarten Zungen vorbeigeleitete Luftströme lassen
sich eben solche Töne und von demselben Klang hervorbringen,,
als wenn die Zungen wie Klappen bewegt werden; überdiess
giebt es eine Stellung der Zunge an einem .Zungenwerk, sowohl
bei metallischer als membranöser Zunge, wo die Zunge gar nicht
mehr als Klappe sich bewegt, sondern frei vor der Mündung
durch den starken Luftström schwingt, indem der Luftstrom so
stark ist, dass die Zunge, ehe sie die Oeffnung schliessen kann,
schon wieder abschwingt. Endlich lassen sich am künstlichen
Kehlkopf mit Kautschuckbändern die Zungentöne oft noch bei
ansehnlicher Spalte der Zungenlippen angeben. Siehe über die
Theorie der Zungentöne p. 174.
Was die Vergleichung der Stimmbänder mit Saiten betrifft,
(F errein), so hat diese allerdings etwas Richtiges, ist aber, in
anderen Puncten unrichtig. F errein’s Versuche, welche diese
Aehnlichkeit zeigen, gehören unter die besten, die je gemacht
worden sind. Er zeigte [-Mem. de l acad. d. sc. 1741.), dass die
Stimmbänder nach Analogie der Saiten, die von der Luit ange-
sproehen werden, tönen, und dass die Töne der Stimmbänder bei
verschiedener Weite der Stimmritze durchaus nicht verändert
werden. Die Hälfte der Stimmbänder gab ihm die Octave ihres
Grundtons, der dritte Theil die Quinte. Endlich fand er, dass
eine Veränderung der Länge der Bänder von 2-n-3 Linien zu allen
Variationen der Höhe hinreiche (indem die Spannung hier ersetzt,
was bei gleicher«Spannung verschieden lange Saiten tbun).
Wurden gleich diese Versuche von Bertin bestritten, so wurden,
sie von Montagnat, Runge und Wollet bestätigt. Haller Eiern.,
physiol. III. Lib. IX. §. 8. 9. 40* In der That zeigen die früher
erwähnten, von mir angestellten Versuche am künstlichen Kehlkopf
eine vollkommene Parallele. Die Hälfte einer Kautschuck-
zunge gab die Octave ihres Grundtons, und die Versuche mit
mensurirter Spannung der Stimmbänder zeigen auch, dass, diese
Zungen ihre Schwingungen im Allgemeinen ziemlich wie die
Saiten ändern. Ich kann B iot nicht beistimmen, wenn e c