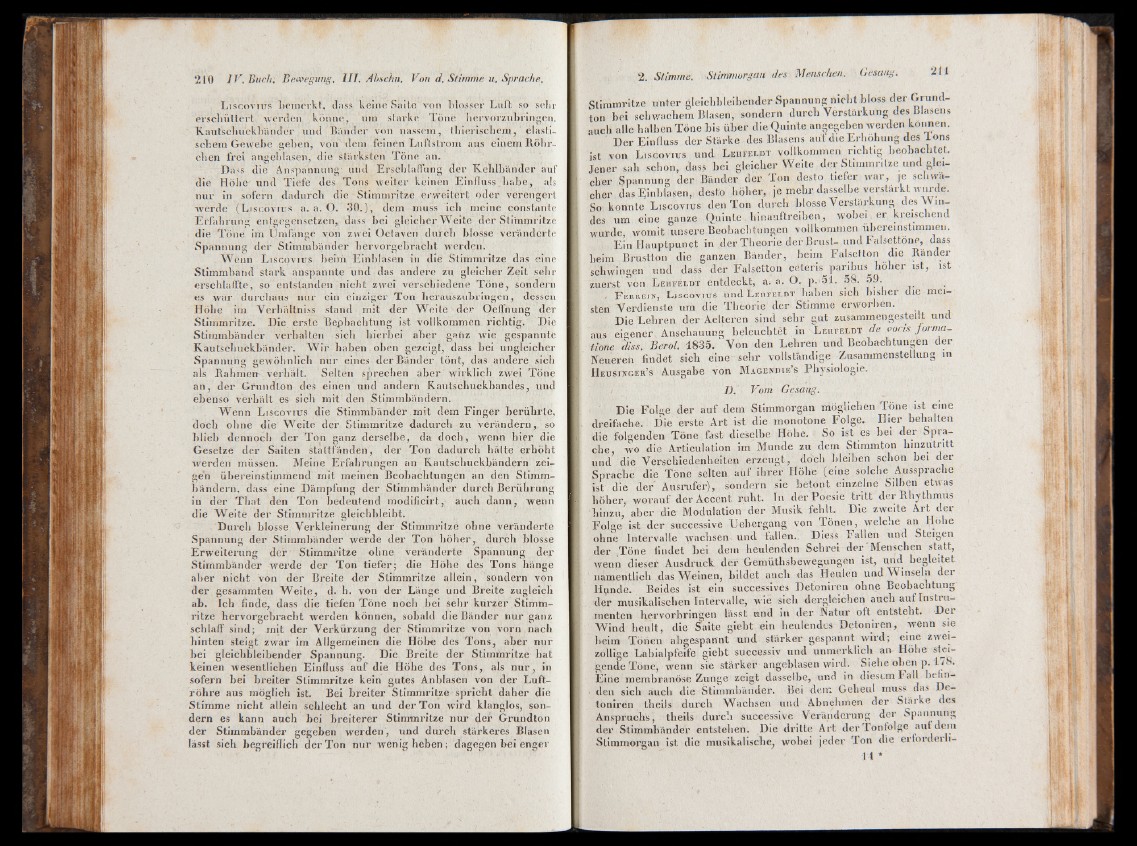
L iscoyius bemerkt, dass keine Saite von blosser Luft so sehr
erschüttert werden könne, um starke Töne hervorzubringen.
Kaütschuckbander und Bänder von nassem, tbierischem, elastischem
Gewebe geben, von dem feinen Luftstrom aus einem Röhrchen
frei an,geblasen, die stärksten Töne an.
Dass die Anspannung und Erschlaffung der Kehlbänder auf
die Höhe und Tiefe des Tons weiter keinen Einfluss,habe, als
nur in sofern dadurch die Stimmritze erweitert oder verengert
werde (L iscoyius a. a. O. 30.), dem muss ich meine constante
Erfahrung entgegensetzen, dass hei gleicher Weite der Stimmritze
die Töne im Umfange von zwei Octaven durch blosse veränderte
Spannung der Stimmbänder hervorgebracht werden.
Wenn Liscoviüs beim Einblasen in die Stimmritze das eine
Stimmhand stark anspannte und das andere zu gleicher Zeit sehr
erschlaffte, so entstanden nicht zwei verschiedene Töne, sondern
es war durchaus nur ein einziger Ton herauszubringen, dessen
Höhe im Verhältniss stand mit der Weite der Oeffnung der
Stimmritze. Die erste Bepbachtung ist vollkommen richtig. Die
Stimmbänder verhalten sich hierbei aber ganz wie gespannte
Kautscbuckbänder. Wir haben oben gezeigt, , dass bei ungleicher
Spannung gewöhnlich nur eines der Bänder tönt, das andere sich
als Rahmen verhält. Selten sprechen aber Wirklich zwei Töne
an, der Grundion des einen und andern Kautschuckbandes, und
ebenso verhält es sich mit den Stimmbändern.
Wenn Liscovuus die Stimmbänder mit dem Finger berührte,
doch ohne die Weite der Stimmritze dadurch zu verändern,/ so
blieb dennoch der Ton ganz derselbe, da doch, wenn hier die
Gesetze der Saiten stattfänden, der Ton dadurch halte erhöht
werden müssen. Meine Erfahrungen an Kautschuckbändern zeigen
übereinstimmend mit meinen Beobachtungen an den Stimmbändern,
dass eine Dämpfung der Stimmbänder durch Berührung
in der That den Ton bedeutend modificirt, auch dann, wenn
die Weite der Stimmritze gleichhleibt.
Durch blosse Verkleinerung der Stimmritze ohne veränderte
Spannung der Stimmbänder werde der Ton höher,, durch blosse
Erweiterung der Stimmritze ohne veränderte Spannung dep
Stimmbänder werde der Ton tiefer; die Höhe des Tons hänge
aber nicht von der Breite -der Stimmritze allein, sondern von
der gesammten Weite, d. h. von der Länge und Breite zugleich
ab. Ich finde, dass die tiefen Töne noch bei sehr kurzer Stimmritze
hervorgebracht werden können, sobald die Bänder nur ganz
schlaff sind; mit der Verkürzung der Stimmritze von vorn nach
hinten steigt zwar im Allgemeinen die Höbe des Tons, aber nur
bei gleichbleibender Spannung. Die Breite der Stimmritze hat
keinen wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Tons, als nur, in
sofern bei breiter Stimmritze kein gutes Anblasen von der Luftröhre
aus möglich ist. Bei breiter Stimmritze spricht daher die
Stimme nicht allein schlecht an und der Ton wird klanglos, sondern
es kann auch bei breiterer Stimmritze nur der Grundton
der Stimmbänder gegeben werden , und durch stärkeres Blasen
lässt sich begreiflich der Ton nur wenig heben; dagegen bei enger
2.11
Stimmritze unter gleichbleibender Spannung nicht bloss der Grundton
bei schwachem Blasen, sondern durch Verstärkung des Biasens
auch alle halben Töne bis über die Quinte angegeben werden können.
Der (Einfluss der Stärke des Biasens auf die Erhöhung des Ions
ist von L iscoyius und Lehfeuut vollkommen richtig beobachtet.
Jener sah schon, das? bei gleicher Weite der Stimmritze und gleicher
Spannung der Bänder der Ton desto tiefer war, je schwächer
das Einblasen, desto höher, je mehr dasselbe verstärkt wurde.
So konnte Liscoviüs den Ton durch blosse Verstärkung des Windes
um eine ganze Quinte. hinauftreiben, wobei er kreischend
wurde, womit unsere Beobachtungen vollkommen übereinstimmen.
Ein Hauptpunct in der Theorie der Brust- und Falsettöne, dass
beim Brustton die ganzen Bänder, beim Falsetton die Ränder
schwingen und dass der Falsetton céteris paribus^ höher ist, ist
zuerst von L ehfelbt entdeckt, a. a. O. W5J. 58. 59.
/ F errein, Ljscovius und L ehfeldt haben sich bisher die mei-
sten Verdienste um die Theorie der Stimme erworben.
Die'Lehren der Aelteren sind sehr gut zusammengestellt und
aus eigener Anschauung beleuchtet in Lehfeldt de vocis jorma-
t.ione diss. Berol. 1835. " Von den Lehren und Beobachtungen der
Neueren findet sich eine' sehr vollständige Zusammenstellung in
Heusinger’s Ausgabe von Magekdie’s Physiologie.
I). Vom Gesang.
Die Folge)der auf dem Stimmorgan möglichen Töne ist eine
dreifache. Die erste Art ist die monotone Folge. Hier behalten
die folgenden Töne fast dieselbe Höhe. So ist es bei der Sprache,
wo die Articulation im Munde zu dem Stimmton hinzutritt
und die Verschiedenheiten erzeugt, doch bleiben schon bei der
Sprache die Töne selten auf ihrer Höhe (eine solche Aussprache
ist die der Ausrufer), sondern sie betont einzelne Silben etuas
höher, worauf der Accent ruht. In der Poesie tritt der Rhythmus
hinzu, aber die Modulation der Musik fehlt. Die zweite Art der
Folge ist der successive Uebergang von Tönen, welche an Höhe
ohne Intervalle wachsen, und lallen.. Diess Fallen und Steigen
der Töne findet bei dem heulenden Schrei der Menschen statt,
wenn dieser Ausdruck der Gemüthsbewegungen ist, und begleitet
namentlich das Weinen, bildet auch das Heuten und Winseln der
Hpnde. Beides ist ein successives Detoniren ohne Beobachtung'
der musikalischen Intervalle, wie sich dergleichen auch auf Instiu-
menten hervorbringen lässt und in der Natur oft entsteht. Der
Wind heult, die £aite giebt ein heulendes Detoniren, wenn sie
beim Tönen abgespannt und stärker gespannt wird; eine zweizöllige
Labialpfeife giebt successiv und unmerklich an Höhe steigende
Töne, wenn sie stärker angeblasen wird. Siehe oben p. 1 ƒ 8.
Eine membranöse Zunge zeigt dasselbe, und in diesem Ball befinden
sich auch die Stimmbänder. Bei dem Geheul muss das Detoniren
theils durch Wachsen und Ahnehmen der Starke des
Anspruchs, theils durch successive Veränderung der Spannung
der Stimmbänder entstehen. Die dritte Art der Tonfolge auf dem
Stimmorgan ist die musikalische, wobei jeder Ton die erforderh