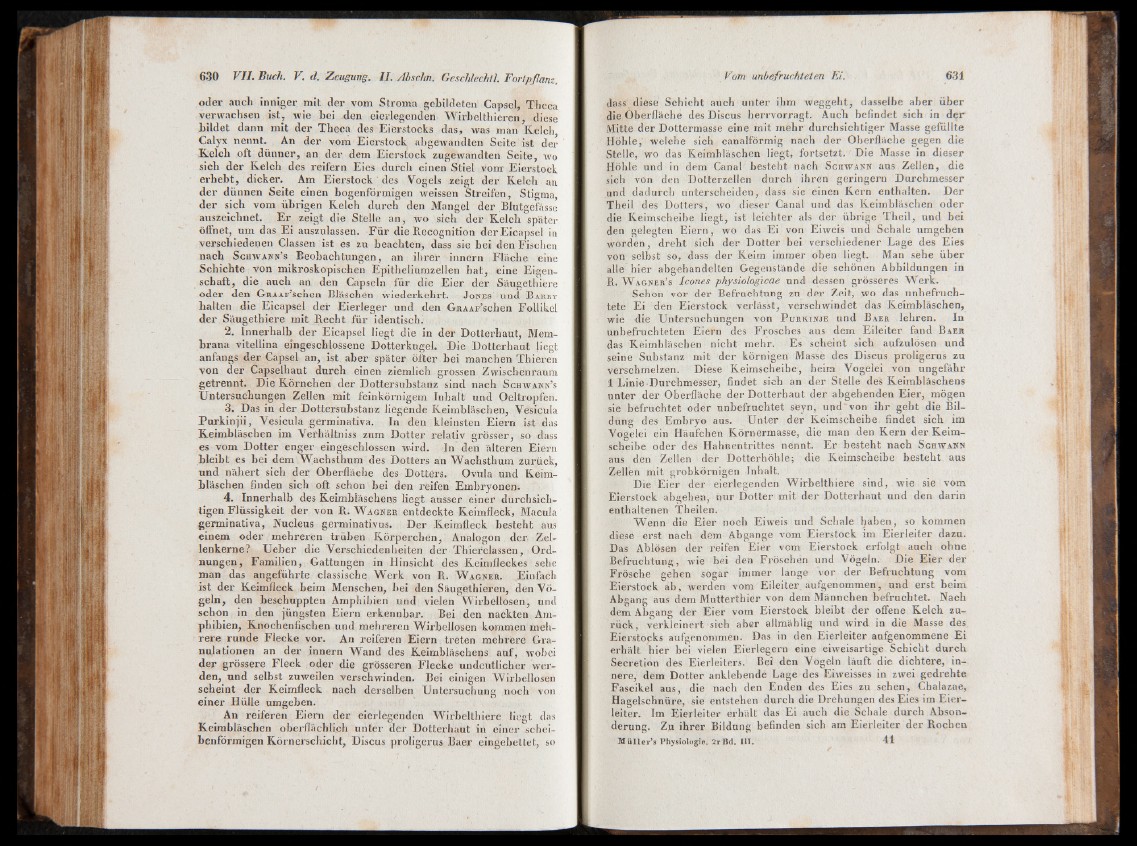
oder auch inniger mit der vom Stroma gebildeten Capsel, Tbeca
verwachsen ist, wie bei den eierlegenden Wirbelthieren, diese
bildet dann mit der Tbeca des Eierstocks das, was man Kelch
Calyx nennt. An der vom Eierstock abgewandten Seite ist der
Kelch oft dünner, an der dem Eierstock zugewandten Seite, wo
sich der Kelch des reifem Eies durch einen Stiel vonr Eierstock
erhebt, dicker. Am Eierstock des Vogels zeigt der Kelch an
der dünnen Seite einen bogenförmigen weissen Streifen, Stigma,
der sich vom übrigen Kelch durch den Mangel der Blutgefässe
auszeichnet. Er zeigt die Stelle an, wo sich der Kelch spater
öffnet, um das Ei ausznlassen. Für die Recognition derEicapsel in
verschiedenen Classen ist es zu beachten, dass sie bei den Fischen
nach S chwann’s Beobachtungen, an ihrer innern Flache eine
Schichte von mikroskopischen Epitheliumzellen hat, eine Eigenschaft,
die auch an den Capsein für die Eier der Säugethiere
oder den GRAAF'schen Bläschen wiederkehrt. J ones und B arry
halten die Eicapsel der Eierleger und den GRAAF’schen Follikel
der Säugethiere mit Recht für identisch.
2. Innerhalb der Eicapsel liegt die in der Dotterhaut, Membrana
vitellina eingeschlossene Dotterkugel. Die Dotterhaut liegt
anfangs der Capsel an, ist aber später öfter bei manchen Thieren
von der Capseihaut durch einen ziemlich grossen Zwischenraum
getrennt. Die Körnchen der Dottersubstanz sind nach Schwann’s
Untersuchungen Zellen mit feinkörnigem Inhalt und Oeltropfen.
3. Das in der Dottersubstanz liegende Keimbläschen, Vesicula
Purkinjii, Vesicula germinativa. In den kleinsten Eiern ist das
Keimbläschen im Verhältniss zum Dotter relativ grösser, so dass
es vom Dotter enger eingeschlossen wird. In den älteren Eiern
bleibt es bei dem Wachsthum des Dotters an Wachsthum zurück,
und nähert sich der Oberfläche des Dotters. Ovula und Keimbläschen
finden sich oft schon bei den reifen Embryonen.
4. Innerhalb des Keimbläschens liegt ausser einer durchsichtigen
Flüssigkeit der von R. W agner entdeckte Keimfleck, Macula
germinativa, Nucleus germinativus. Der Keimfleck besteht aus
einem oder mehreren trüben Körperchen, Analogon der Zellenkerne?
Ueber die Verschiedenheiten der Thierclassen, Ordnungen,
Familien, Gattungen in Hinsicht des Keimfleckes sehe
man das angeführte classische Werk von R. W agner. Einfach
ist der Keimfleck beim Menschen, bei den Säugethieren, den Vögeln,
den beschuppten Amphibien und vielen Wirbellosen, und
schon in den jüngsten Eiern erkennbar. Bei den nackten Amphibien,
Knochenfischen und mehreren Wirbellosen kommen mehrere
runde Flecke vor. An reiferen Eiern. treten mehrere Granulationen
an der innern Wand des Keimbläschens auf, wobei
der grössere Fleck oder die grösseren Flecke undeutlicher werden,
und selbst zuweilen verschwinden. Bei einigen Wirbellosen
scheint der Keimfleck nach derselben Untersuchung noch von
einer Hülle umgeben.
An reiferen Eiern der eierlegenden Wirbelthiere liegt das
Keimbläschen oberflächlich unter der Dotterhaut in einer scheibenförmigen
Körnerschicht, Discus proligerus Baer eingebettet, so
dass^ diese Schicht auch unter ihm weggeht, dasselbe aber über
die Oberfläche des Discus herrvorragt. Auch befindet sich in der
Mitte der Dottermasse eine mit mehr durchsichtiger Masse gefüllte
Höhle,' welche sich canalförmig nach der Oberfläche gegen die
Stelle, wo das Keimbläschen liegt, fortsetzt. Die Masse in dieser
Höhle und in dem Canal besteht nach S chwann aus Zellen, die
sich von den Dbtterzellen durch ihren geringem Durchmesser
und dadurch unterscheiden, dass sie einen Kern enthalten. Der
Theil des Dotters, wo dieser Canal und das Keimbläschen oder
die Keimscheibe liegt, ist leichter als der übrige Theil, und bei
den gelegten Eiern, wo das Ei von Eiweis und Schale umgehen
worden, dreht sich der Dotter bei verschiedener Lage des Eies
von selbst so, dass der Keim immer oben liegt. Man sehe über
alle hier abgehandelten Gegenstände die schönen Abbildungen in
R. W agner’s Icones physiologicae und dessen grösseres Werk.
Schon vor der Befruchtung zu der Zeit, wo das unbefruchtete
Ei den Eierstock verlässt, verschwindet das Keimbläschen,
wie die Untersuchungen von P urkinje und Baer lehren. In
unbefruchteten Eiern des Frosches aus dem Eileiter fand B aer
das Keimbläschen nicht mehr. Es scheint sich aufzulösen und
seine Substanz mit der körnigen Masse des Discus proligerus zu
verschmelzen. Diese Keimscheibe, beim Vogelei von ungefähr
1 Linie Durchmesser, findet sich an der Stelle des Keimbläschens
unter der Oberfläche der Dotterhaut der abgehenden Eier, mögen
sie befruchtet oder unbefruchtet s'eyn, und'von ihr geht die Bildung
des Embryo aus. Unter der Keimscheibe findet sich im
Vogelei ein Häufchen Körnermasse, die man den Kern der Keimscheibe
oder des Hahnentrittes nennt. Er besteht nach Schwann
aus den Zellen der Dotterhöhle; die Keimscheibe besteht aus
Zellen mit grobkörnigen Inhalt.
Die Eier der eierlegenden Wirbelthiere sind, wie sie vom
Eierstock abgehen, nur Dotter mit der Dotterhant und den darin
enthaltenen Theilen.
Wenn die Eier noch Eiweis und Schale haben, so kommen
diese erst nach dem Abgänge vom Eierstock im Eierleiter dazu.
Das Ablösen der reifen Eier vom Eierstock erfolgt auch ohne
Befruchtung, wie bei den Fröschen und Vögeln. Die Eier der
Frösche gehen sogar immer lange vor der Befruchtung vom
Eierstock ab, werden vom Eileiter, aufgenommen, und erst beim
Abgang aus dem Mutterthier von dem Männchen befruchtet. Nach
dem Abgang der Eier vom Eierstock bleibt der offene Kelch zurück,
verkleinert sich aber allmählig und wird in die Masse des
Eierstocks aufgenommen. Das in den Eierleiter aufgenommene Ei
erhält hier bei vielen Eierlegern eine eiweisartige Schicht durch
Secretion des Eierleiters. Bei den Vögeln läuft die dichtere, innere,
dem Dotter anklebende Lage des Eiweisses in zwei gedrehte
Fascikel aus, die nach den Enden des Eies zu sehen, Chalazae,
Hagelschnüre, sie entstehen durch die Drehungen des Eies im Eierleiter.
Im Eierleiter erhält das Ei auch die Schale durch Absonderung.
Zu ihrer Bildung befinden sich am Eierleiter der Rochen
MUller’s Physiologie, 2rBd. 111. 41