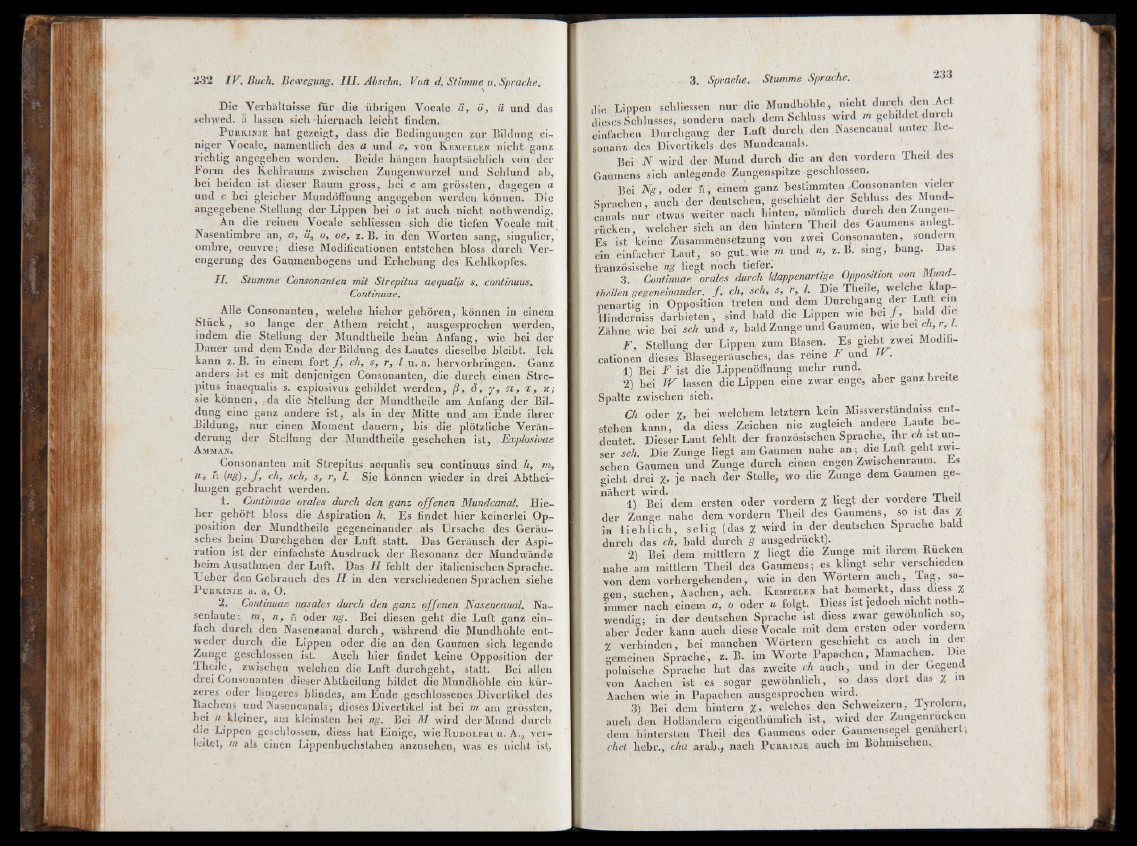
Die Verhältnisse für die übrigen Vocale ä, ö , ii und das
schied, ä lassen sich -hiernach leicht finden.
P urkinje hat gezeigt, dass die Bedingungen zur Bildung einiger
Vocale, namentlich des a und c, von K èmpelen nicht ganz
richtig angegeben worden. Beide hängen hauptsächlich von der
Form des Ivehiraums zwischen Zungenwurzel und Schlund ah,
bei beiden ist- dieser Raum gross, hei e am grössten, dagegen a
und e hei gleicher Mundöffnung angegeben werden können. Die
angegebene Stellung der Lippen hei o ist auch nicht nothwendig,
An die reinen Vocale schliessen- sich die tiefen Vocale mit
Nasentimbre an, a, ä, o, oe, z. B. in den Worten sang, singulier,
ombre, oeuvre; diese Modificationen entstehen bloss 'durch Verengerung
des Gagmenbogens und Erhebung des Kehlkopfes.
II. Stumme Consonanten mit Strepitus aegualfs s. continuus.
Continuae,
Alle Consonanten, welche hieber gehören, können in einem
Stück, so lange der Athem reicht, ausgesprochen werden,
indem die Stellung der Mnndtlieile beim Anfang, wie bei der
Dauer und dem Ende der Bildung des Lautes dieselbe bleibt. Ich
kann z. B. in einem fort / , ch, s, r, l u. a. hervorbringen. Ganz
anders ist es mit denjenigen Consonanten, die durch einen Strepitus
inaequalis s. expiosivus gebildet werden, ß , ö , y , n , r , x ;
sie können, da die Stellung der Mundtheile am Anfang der Bildung
eine ganz andere ist, als in der Mitte und am Ende ihrer
Bildung, nur einen Moment dauern, bis die plötzliche Veränderung
der Stellung der .Mundtheile geschehen ist, Explosime
Amman,
Consonanten mit Strepitus aequalis seu continuus sind h, ja,
n, h (ng), j , ch, sch, s, r, l. Sie können wieder in drei Abthei-
luugen gebracht werden.
1. Continuae orales durch den ganz, offenen Mundcanal, flie-
her geh oft bloss die Aspiration h. Es findet hier keinerlei Opposition
der Mundtheile gegeneinander als Ursache des Geräusches
beim'Durchgehen der Luft statt. Das Geräusch der Aspiration
ist der einfachste Ausdruck der Resonanz der Mundwände
beim Apsathmen der Luft, Das M fehlt der italienischen Sprache.
Ueber den Gebrauch des H in den verschiedenen Sprachen siehe
P urkinje a. a, O.
■2. Continuae nasales durch den ganz, offenen Nasencanal. Nasenlaute:
m, n, fl oder ng. Bei diesen geht die Luft ganz einfach
dureh den Naseneanal durch, während die Mundhöhle entweder
durch die Lippen oder die an den Gaumen sich legende
Zunge geschlossen ist. Auch hier findet keine Opposition der
Theile, zwischen welchen die Luft durchgeht, statt. Bei allen
drei Consonanten dieser Abtheilung bildet die Mundhöhle ein kürzeres
oder längeres blindes, am Ende geschlossenes Divertikel des
Rachens und'Nasencanals; dieses Divertikel ist bei m am grössten,
bei n kleiner, am kleinsten bei ng. Bei M wird der Mund durch
die Lippen geschlossen, diess hat Einige, wie R u d o l ph iu. A., verleitet,
m als einen Lippenbychstabeu anzusehen, was es nicht ist,
die Lippen schliessen nur die Mundhöhle, nicht durch den Act
dieses Schlusses, sondern nach dem Schluss wird m gebildet durch
einfachen Durchgang der Luft durch den Nasencanal unter Resonanz
des Divertikels des Mundcanals.
Bei N wird der Mund durch die an den vordern Thed des
Gaumens sich anlegende Zungenspitze geschlossen.
Bei Ng, oder n, einem ganz bestimmten Consonanten vieler
Sprachen, auch der deutschen, geschieht der Schluss des Mundcanals
nur etwas weiter nach hinten, nämlich durch den Zungenrücken,
welcher sich an den hintern Thed des Gaumens anlegt.
Es ist keine Zusammensetzung von zwei Consonanten, sondern
ein einfacher Laut, so gut-wie'm und n, z. B. sing, bang. Gas
französische ng liegt noch tiefer. V tw 3 Continuae orales durch klappenartige Opposition von Mund-
theilen gegeneinander, f , ch, sch, s, r, l. Die Theile, welche klap.-
penartig in Opposition treten und dem Durchgang der Luft ein
Hinderniss darbieten, sind bald die Lippen wie b e i / , bald die
Zähne, wie bei sch und n, bald Zunge und Gaumen, wie bei ch, r, l.
F , Stellung der Lippen zum Blasen. Es giebt zwei Modifi-
cationen dieses Blasegeräusches, das* reine F und
1) Bei F ist die Lippenöffnung mehr rund.
2) hei W lassen die Lippen eine zwar enge, aber ganz breite
Spalte zwischen sich.
Ch oder %, bei welchem letztem kein Missverständnis entstehen
kann, da diess .Zeichen nie zugleich andere Laute bedeutet.
Dieser Laut fehlt der französischen Sprache, ihr cA ist unser
sch. Die Zunge liegt am Gaumen nahe an; die Luft geht zwischen
Gaumen und Zunge durch einen en g en Zwischenraum. Ls
giebt drèi %, je nach der Stelle, wo die Zunge dem Gaumen genähert
wird. ■ .
1) Bei dem ersten oder vordern % liegt der vordere Iheu
der Zunge nahe dem vordern Theil des Gaumens, so ist das %
in lie b lic h , selig (das X wird in der deutschen Sprache bald
durch das ch, bald durch g ausgedrückt).
2) Bei dem mittlern % liegt die Zunge mit ihrem Rucken
nahe am mittlern Theil des Gaumens; es klingt sehr verschieden
von dem vorhergehenden, wie in den Wörtern auch, lag , sagen,
suchen, Aachen, ach. K empelen hat bemerkt, dass diess %
immer nach einem a, ö oder « folgt, Diess ist ]edoch nicht nothwendig;
in der deutschen Sprache ist diess zwar gewöhnlich so,
aber Jeder kann auch diese Vocale mit dem ersten oder vordern
y verbinden, bei manchen Wörtern géschieht es auch in der
gemeinen Sprache, z. B. im Worte Papachen, Mamachen. Die
polnische Sprache hat das zweite ch auch, und m der Gegend
von Aachen ist es sogar gewöhnlich, so dass dort das % in
Aachen wie in Papachen ausgesprochen wird. ■
3) Bei dem hintern %, welches den Schweizern, lyroiern,
auch den Holländern eigenthümlich ist, wird der Zungenrücken
dem hintersten Theil des Gaumens oder Gaumensegel genähert;
rhet hebr., cha arab-, nach Purkinje auch im Böhmischen.