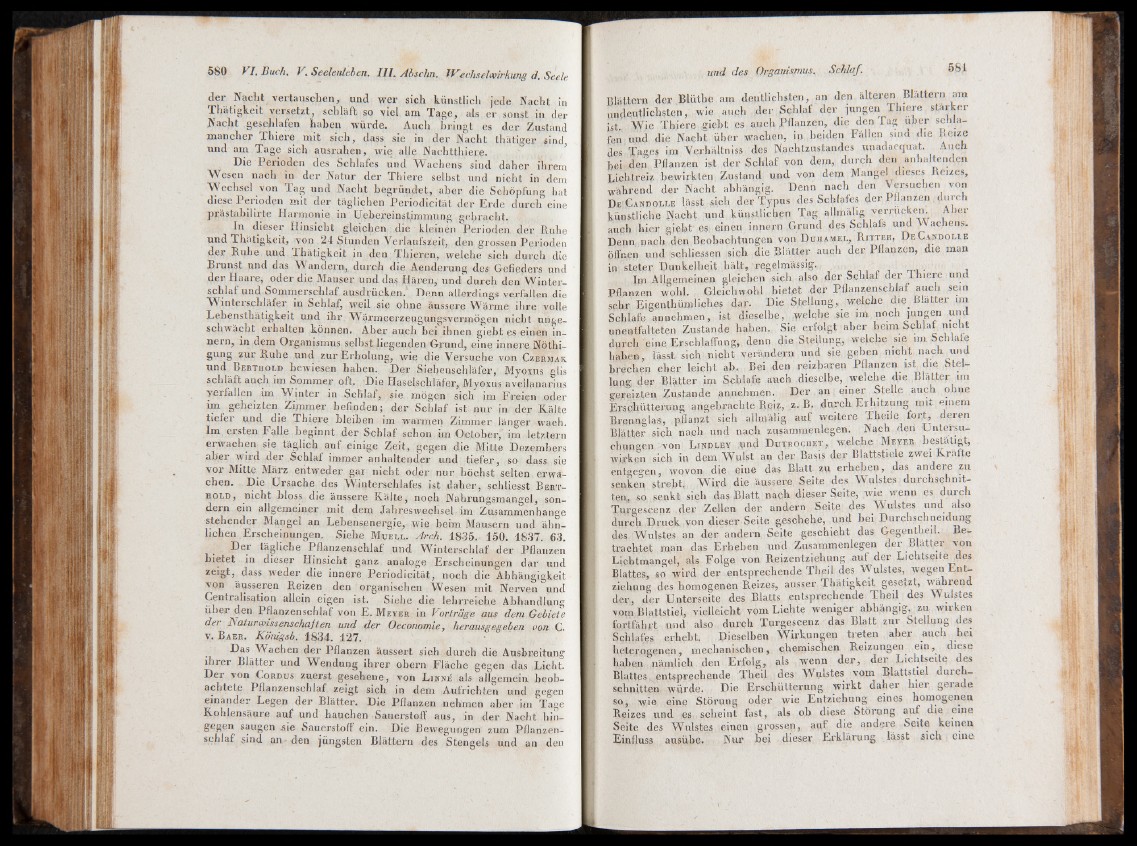
der Nacht vertauschen, und wer sich künstlich jede Wacht in
Thätigkeit versetzt, schläft so viel am Tage, als er sonst in der
Wacht geschlafen haben würde. Auch bringt es der Zustand
mancher Tbiere mit sich, dass sie in der Nacht thätiger sind,
und am Tage sich ausruhen, wie alle Nachtthiere.
Die Perioden des Schlafes und Wachens sind daher ihrem
Wiesen nach in der Natur der Thiere selbst und nicht in dem
Wechsel von Tag und Nacht begründet, aber die Schöpfung hat
diese Perioden mit der täglichen Periodicität der Erde durch eine
prästabilirte Harmonie in Uebereinstimmung gebracht.
In dieser Hinsicht gleichen die kleinén Perioden der Ruhe
Thätigkeit, von 24 Stunden Verlaufszeit, den grossen Perioden
der Ruhe und Thätigkeit in den Thieren, welche sich durch die
Brunst und das Wandern, durch die Afjnderung des Gefieders und
der Haare, oder die Mauser und das Hären, und'durch den Winterschlaf
und Sommerschlaf ausdrücken. Denn allerdings verfallen die
Winteischläler in Schlaf, weil sie ohne äussere Wärme ihre volle
Lebensthätigkeit und ihr "Warmeerzengungsvermögen nicht ungeschwächt
erhalten können. Aber auch bei ihnen giebt es einen in-
nern, in dem Organismus selbst liegenden Grund, eine innere Nöthi-
gung zur Ruhe und zur Erholung, wie die Versuche von Czermak.
und Berthold bewiesen haben. Der Siebenschläfer, Myoxus glis
schläft auch im Sommer oft. Die Haselschläfer, Myoxus avellanarius
yerfallen im Winter in Schlaf, sie mögen sich im Freien oder
im geheizten Zimmer befinden; der Schlaf ist nur in der Kälte
tiefer und die Tbiere bleiben im warmen Zimmer länger wach.
Im ersten Falle beginnt der Schlaf schon im October, im letztem
erwachen sie täglich auf einige Zeit, gegen die Mitte Dezembers
aber wird der Schlaf immer anhaltender und tiefer, so dass sie
vor Mitte März entweder gar nicht oder nur höchst selten erwachen.
Die Ursache des Winterschlafes ist daher, schliesst B ert-
hold, nicht bloss die äussere Kälte, noch Nahrungsmangel, sondern
ein allgemeiner mit dem Jahreswechsel im Zusammenhänge
stehender Mangel an Lebensenergie, wie beim Mausern und ähnlichen
Erscheinungen. Siehe Muell. Arch. 1835.- 450. 1837. 63.
Der tägliche Pflanzenschlaf und Winterschlaf der Pflauzen
bietet in dieser Hinsicht ganz analoge Erscheinungen dar und
zeigt, dass weder die innere Periodicität, noch die Abhängigkeit
von äusseren Reizen den organischen Wesen mit Nerven und
Centralisation allein eigen ist. Siehe die lehrreiche Abhandlung
über den Pflanzenschlaf von E. Meyer in Vorträge aus dem Gebiete
der haturwlssenschajten und der O economie, herausgegeben von C.
v. Baer. Königsb. 1834. 127.
Das Wachen der Pflanzen äussert sich durch die Ausbreitung
ihrer Blätter und Wendung ihrer ohern Fläche gegen das Licht.
Der von Cordus zuerst gesehene, von Luxui! als allgemein beobachtete
Pflanzenschlaf zeigt sich in dem Aufrichten und gegen
einander Legen der Blätter. Die Pflanzen nehmen aber im Tage
Kohlensäure auf und hauchen Sauerstoff aus, in der Nacht hingegen
saugen .sie Sauerstoff ein. Die Bewegungen zum Pflanzenschlaf
sind an den jüngsten Blättern des Stengels und an den
Blättern der Blüthe am deutlichsten, an den älteren Blättern am
undeutlichsten, wie auch der Schlaf der jungen Thiere starker
ist. Wie Thiere gieht es auch Pflanzen, die den Tag über schlafen
und die Nacht über wachen, in beiden Fällen sind die Reize
des Tage? im Verhältniss des Nachtzustandes unadaeejuat. Auch
hei den Pflanzen ist der Schlaf von dem, durch den anhaltenden
Lichtreiz bewirkten Zustand und von dem Mangel dieses Reizes,
während der Nacht abhängig. Denn nach den Versuchen von
D e'Candolle lässt sich der Typus des Schlafes der Pflanzen durch
künstliche Nacht und künstlichen Tag allmälig verrücken Aber
auch hier gieht es einen innern Grund des Schlafs und Wachens.
Denn nach den Beobachtungen von D uhamel, R itter, D e L andolle
öffnen und schliessen sich die Blätter auch der Pflanzen, die man
in steter Dunkelheit hält, regelmässig. . . .
Im Allgemeinen gleichen $ich also der Schlaf der Thiere und
Pflanzen wohl. Gleichwohl bietet der Pflanzenschlaf auch sein
sehr Eigentümliches dar. Die Stellung, welche die^ Blätter im
Schlafe annehmen, ist dieselbe, welche sie im noch jungen und
unentfalteten Zustande haben. Sie erfolgt aber beim Schlaf nicht
durch eine Erschlaffung, denn die Stellung, welche sie im Schlafe
haben, lässt sich nicht verändern und sie geben nicht nach und
brechen eher leicht ab. Bei den reizbaren Pflanzen ist die Stel-
lupg. der Blätter im Schlafe auch dieselbe, welche die Blatter im
gereizten Zustande annehmen. Der an einer Stelle auch ohne
Erschütterung angebrachte Reiz, z. B. durch,Erhitzung mit.einem
Brennglas, pflanzt sich allmälig auf weitere Theiie fort, deren
Blätter sich nach und nach Zusammenlegen. Nach den Untersuchungen
von L indley lind D utrochet, welche Meyer bestätigt,
wirken sich in dem Wulst an der Basis der Blattstiele zwei Kräfte
entgegen, wovon die eine das Blatt zu erheben, das andere zu
senken strebt Wird die äussere Seite des Wulstes durchschnitten,,
so senkt sich das Blatt nach dieser Seite, wie wenn es durch
Turgescenz der Zellen der andern Seite des Wulstes und also
durch Druck von dieser Seite geschehe, und bei Durchschneidung
des. Wulstes an der andern Seite geschieht das Gegentheil. Betrachtet
man das Erheben und Zusammenlegen der Blätter Wn
Lichtmangel, als Folge von Reizentziehung auf der Lichtseite des
Blattes, sö wird der entsprechende Theil des Wulstes, wegen Entziehung
des homogenen Reizes, ausser Thätigkeit gesetzt, während
der, der Unterseite des Blatts entsprechende Theil des Wulstes
vom Blattstiel, vielleicht vom Lichte weniger abhängig, zu wirken
fortfährt und also durch Turgescenz das Blatt zur Stellung des
Schlafes, erhebt. Dieselben Wirkungen treten aber auch bei
heterogenen, mechanischen, chemischen Reizungen ein, diese
haben nämlich den Erfolg, als wenn der, der Lichtseite des
Blattes, entsprechende Theil des Wulstes vom Blattstiel durchschnitten
würde. Die Erschütterung wirkt daher hier gerade
so, wie eine Störung oder wie Entziehung eines homogenen
Reizes und es scheint fast, als ob diese Störung auf die eine
Seite des Wulstes, einen grossen, auf die andere Seite keinen
Einfluss, ausübe. Nur bei dieser Erklärung lässt sich eine