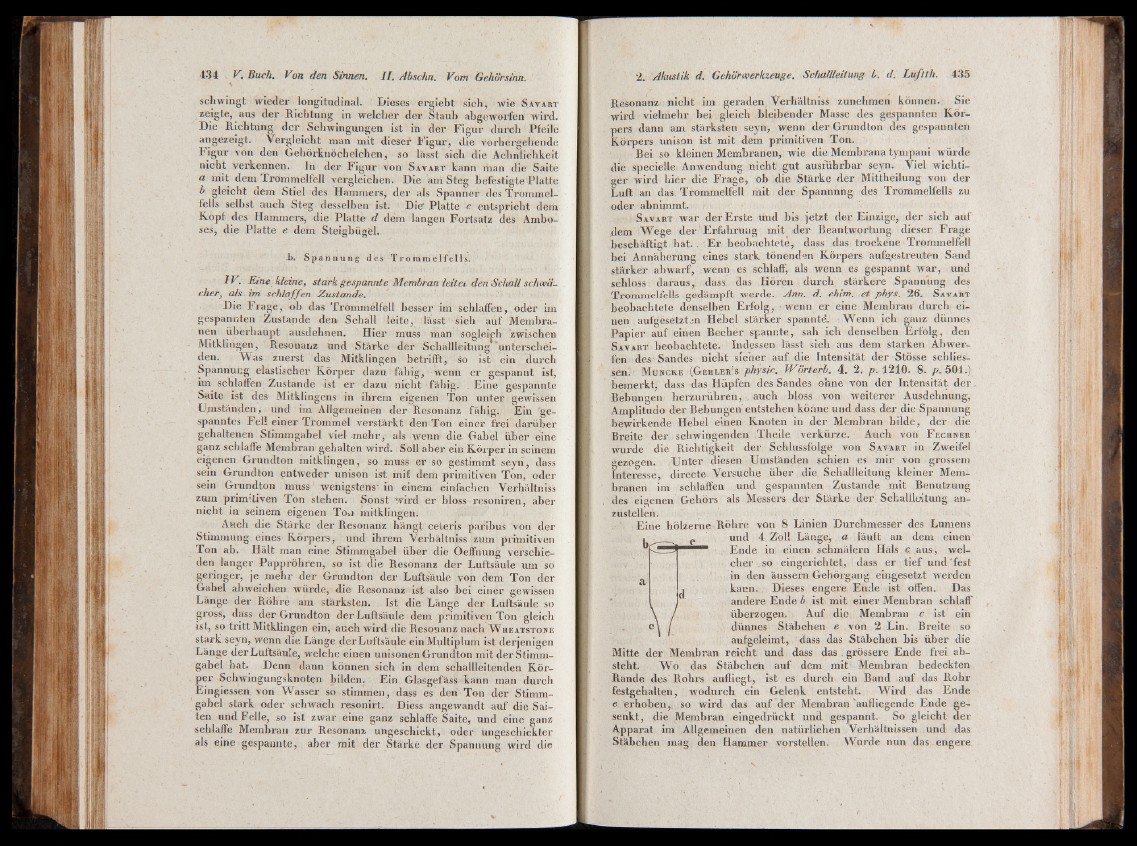
schwingt wieder longitudinal. Dieses ergiebt sich, wie S avabt
zeigte, aus der Richtung in welcher der Staub abgeworfen wird.
Die Richtung der Schwingungen ist in der Figur durch Pfeile
angezeigt. Vergleicht man mit diesem Figur, die vorhergehende
Figur von den Gehörknöchelchen, so lässt sich die Aebnlichkeit
nicht verkennen. In der Figur von S avabt kann man die Saite
a mit dem Trommelfell vergleichen. Die am Steg befestigte Platte
b gleicht dem Stiel des Hammers, der als Spanner des Trommelfells
seihst auch Steg desselben ist. Die’ Platte c entspricht dem
Kopf des Hammers, die Platte- d dem langen Fortsatz des Ambo-
ses, die Platte e dem Steigbügel.
b. S p a n n u n g d e s T r o m m e l f e l l s ,
EV. Eine kleine, stark gespannte Membran leitet den Schall schwächer,
als im schlaffen Zustande.
Die Frage, ob das Trommelfell besser im schlaffen, oder im
gespannten Zustande den Schall leite, lässt sich auf Membranen
überhaupt ausdehnen. Hier muss man sogleich zwischen
Mitklingen, Resonanz und Stärke der Schallleitung’unterscheiden.
Was zuerst das Mitklingen betrifft, So ist ein durch
Spannung elastischer Körper dazu fähig, wenn er gespannt ist,
im schlaffen Zustande ist er dazu nicht fähig. , Eine gespannte
Saite ist des Mitklingens in ihrem eigenen Ton unter gewissen
Umständen, und im Allgemeinen der Resonanz fähig. Ein 'gespanntes
Fell einer Trommel verstärkt den Ton einer frei darüber
gehaltenen Stimmgabel viel -mehr, als wenn die Gabel über eine
ganz schlaffe Membran gehalten wird. Soll aber ein Körper in seinem
eigenen Grundton mitklingen, so muss er so gestimmt seyn, dass
sein Grundton entweder unison ist mit dem primitiven Ton, oder
sein Grundton muss wenigstens'in einem einfachen Verhältniss
zum primitiven Ton stehen. Sonst wird er bloss. resoniren, aber
nicht in seinem eigenen Ton mitklingen.
Auch die Stärke der Resonanz hängt ceteris paribus von der
Stimmung eines Körpers, und ihrem Verhältniss zum primitiven
Ton ab. Hält man eine Stimmgabel über die Oeffnung verschieden
langer Pappröhren, so ist die Resonanz der Luftsäule um so
geringer, je mehr der Gruhdton der Luftsäule von dem Ton der
Gabel abweichen würde, die Resonanz ist also bei einer gewissen
Länge der Röhre am stärksten. Ist die Länge der Luftsäule so
gross, dass der Grundton der Luftsäule dem primitiven Ton gleich
ist, so tritt Mitklingen ein, auch wird die Resonanz nach W heatstone
stark seyn, wenn die Länge der Luftsäule ein Multiplum ist derjenigen
Länge der Luftsäule, welche einen unisonen Grundton mit der Stimmgabel
bat. Denn dann können sich in dem schallleitenden Körper
Schwingungsknoten bilden. Ein Glasgefäss kann man durch
Eingiessen, von Wasser so stimmen, dass es den Ton der Stimmgabel
stark oder schwach resonirt. Diess angewandt auf die Saiten
und Felle, so ist zwar eine ganz schlaffe Saite, und eine ganz
schlaffe Membran zur Resonanz ungeschickt, oder ungeschickter
als eine gespannte, . aber mit der Stärke der Spannung wird die
Resonanz nicht im geraden, Verhältniss zunehmen können. Sie
wird vielmehr bei gleich bleibender Masse des gespannten Körpers
dann am stärksten seyn, wenn <ler Grundton des gespannten
Körpers unison ist mit dem primitiven Tön.
Bei so kleinen Membranen, wie die Membrana tympani würde
die specielle Anwendung nicht gut ausführbar seyn. Viel wichtiger
wird hier die Frage, ob die Stärke der Mittheilung von der
Luft an das. Trommelfell mit der Spannnng des Trommelfells zu
oder abnimmt.
S avabt war der Erste und bis jetzt der Einzige, der sich auf
dem Wege der' Erfahrung mit der Beantwortung dieser Frage
beschäftigt hat. . Er beobachtete, dass das trockene Trommelfell
bei Annäherung eines stark tönenden Körpers aufgestreuten Sand
stärker abwarf, wenn es schlaff, als wenn es gespannt war, und
schloss daraus, dass, das Hören durch stärkere Spannung des
Trommelfells gedämpft werde. Ann. d. rhim. et phys. 26. S avabt
beobachtete denselben Erfolg, r wenn er eine Membran durch einen
aufgesetztjn Hebel stärker spannte'. Wenn ich ganz dünnes
Papier auf einen Bechér spannte, sah ich denselben Erfolg, den
Savabt beobachtete. Indessen lässt Sich aus dem starken Abwerfen
des1 Sandes nicht sicher auf die Intensität der Stösse schlies-
sen. Muncke (GehleAs physi.e. Wörterb. 4. 2. p. 1210. 8. p. 501.)
bemerkt, dass das Hüpfen des Sandes ohne' von der Intensität der
Bebungen herzurühren, , auch bloss von weiterer Ausdehnung,
Amplitudo der Bebungen entstehen könne und dass der die Spannung
bewirkende Hebel einen Knoten in der Membran bilde, der die
Breite der schwingenden Theile verkürze. Auch von F echneb
wurde die Richtigkeit der Schlussfolge von S avabt in Zweifel
gezogen. Unter diesen Umständen schien es mir von grossem
Interesse directe Versuche über die Schallleitung kleiner Membranen
im schlaffen und gespannten Zustande mit Benutzung
des eigenen Gehörs als Messers der Stärke der Schaliloturig anzustellen.
Eine hölzerne Röhre von 8 Linien Durchmesser des Lumens
und 4 Zoll Länge, « läuft an dem einen'
* ■ . Ende in einen schmälern Hals c. aus, welcher
so eingerichtet, dass er tief und'fest
in den äüssern Gehörgang eingesetzt werden
kann.. Dieses engere Ende ist offen. Das
andere Ende b ist mit einer Membran schlaff
\ / überzogen. Auf die Membran c ist ein
c\ / dünnes Stäbchen e von 2 Lin. Breite so
aufgeleimt, dass das Stäbchen bis über die
Mitte der Membran reicht und dass das . grössere Ende frei absteht.
Wo das Stäbchen auf dem mit Membran bedeckten
Rande des Rohrs aufliegt, ist es durch ein Band auf das Rohr
festgehalten, wodurch ein Gelenk entsteht. Wird. das Ende
e erhoben, so wird das auf der Membran'aufliegende Ende gesenkt,
die Membran eingedrückt und gespannt. So gleicht der
Apparat im Allgemeinen den natürlichen Verhältnissen und das
Stäbchen mag den Hammer vorstellen. Wurde nun das engere