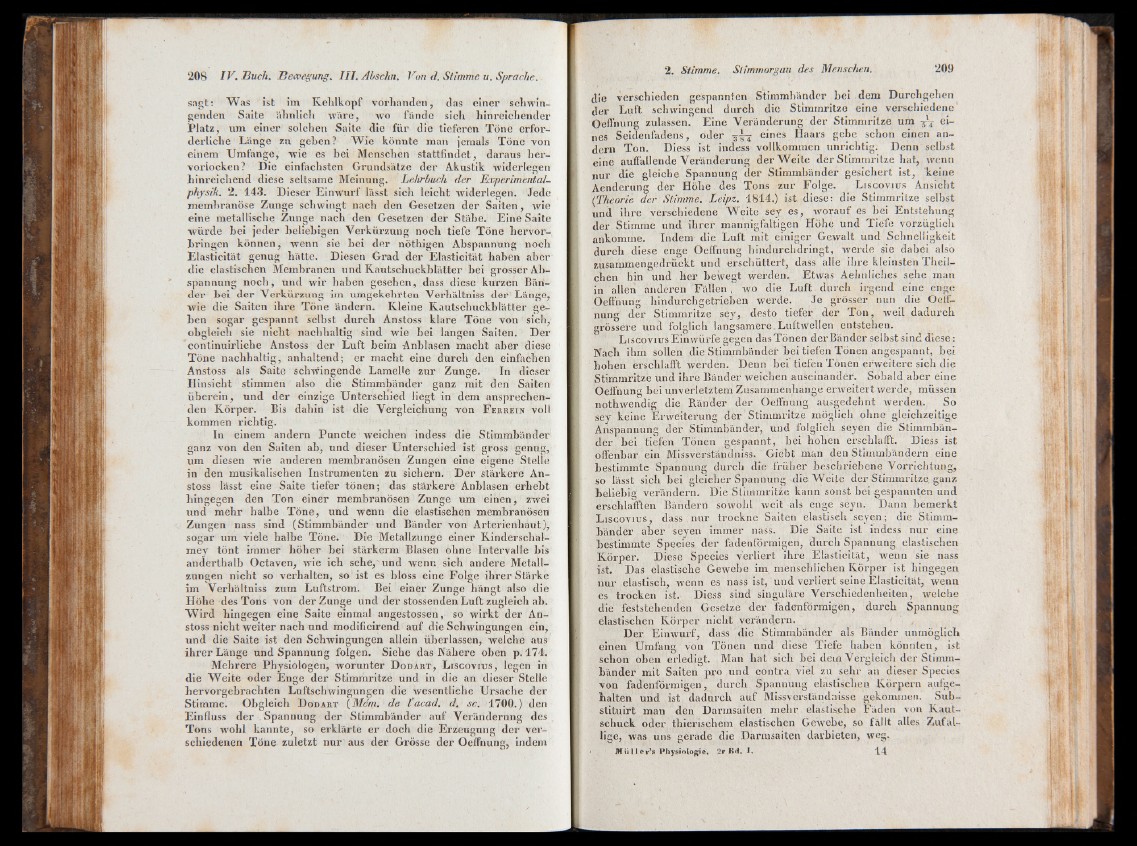
sagt: Was ist im Kehlkopf vorhanden, das einer schwingenden
Saite ähnlich wäre, wo fände sich hinreichender
Platz, um einer solchen Saite die für die tieferen Töne erforderliche
Länge zn gehen? Wie könnte man jemals Töne von
einem Umfange, wie es bei Menschen stattfindet, daraus her-
voriocken? Die einfachsten Grundsätze der Akustik widerlegen
hinreichend diese seltsame Meinung. Lehrbuch der Experimentalphysik.
2. 143. Dieser Einwurf lässt sich leicht widerlegen. Jede
membranöse Zunge schwingt nach den Gesetzen der Saiten, wie
eine metallische Zunge nach den Gesetzen der Stäbe. Eine Saite
würde bei jeder beliebigen Verkürzung noch tiefe Töne hervorbringen
können, wenn sie bei der nöthigen Abspannung noch
Elasticität genug hätte. Diesen Grad der Elasticität haben aber
die elastischen Membranen und Kautschuckblätter bei grosser Abspannung
noch, und wir haben gesehen, dass diese kurzen Bänder
hei der Verkürzung im umgekehrten Verhältniss der Länge,
wie die Saiten ihre Töne ändern. Kleine Kautschuckblätter geben
sogar gespannt selbst durch Anstoss klare Töne von sich,
obgleich sie nicht nachhaltig sind wie hei langen Saiten. Der
continuirliche Anstoss der Luft beim Anblasen macht aber diese
Töne nachhaltig, anhaltend; er macht eine durch den einfachen
Anstoss als Saite schwingende Lamelle zur Zunge. In dieser
Hinsicht stimmen also die Stimmbänder ganz mit den Saiten
überein, und der einzige Unterschied liegt in dem ansprechenden
Körper. Bis dahin ist die Vergleichung von F errein voll
kommen richtig.
In einem andern Puncte weichen indess die Stimmbänder
ganz von den Saiten ab, und dieser Unterschied ist gross genug,
um diesen wie anderen membranösen Zungen eine eigene Stelle
in den musikalischen Instrumenten zu sichern. Der stärkere Anstoss
lässt eine Saite tiefer tönen; das stärkere Anblasen erhebt
hingegen den Ton einer membranösen Zunge um einen, zwei
und mehr halbe Töne, und wenn die elastischen membranösen
Zungen nass sind (Stimmbänder und Bänder von Arterienhaut.),
sogar um viele halbe Töne. Die Metallzunge einer Kinderschal-
mey tönt immer höher bei stärkerm Blasen ohne Intervalle bis
anderthalb Octaven, wie ich sehe,'und wenn sich andere Metallzungen
nicht so verhalten, so ist es bloss eine Folge ihrer Stärke
im Verhältniss zum Luftstrom. Bei einer Zunge hängt also die
Höhe des Tons von der Zunge und der stossenden Luft zugleich ab.
Wird hingegen eine Saite einmal angestossen, so wirkt der Anstoss
nicht weiter nach und modificirend auf die Schwingungen ein,
und die Saite ist den Schwingungen allein überlassen, welche aus
ihrer Länge und Spannung folgen. Siehe das Nähere oben p. 174.
Mehrere Physiologen, worunter D odart, L iscovius, legen in
die Weite oder Enge der Stimmritze und in die an dieser Stelle
hervorgebrachten Luftschwingungen die wesentliche Ursache der
Stimme. Obgleich D odart [Mém. de l’acad. d. sc. 1700.) den
Einfluss der . Spannung der Stimmbänder auf Veränderung des
Tons wohl kannte, so erklärte er doch die Erzeugung der verschiedenen
Töne zuletzt nur aus der Grösse der OefFnung, indem
die verschieden gespannten Stimmbänder bei dem Durchgehen
der Luft schwingend durch die Stimmritze eine verschiedene
OefFnung zulassen. Eine Veränderung der Stimmritze um eines
Seidenfadens, oder eines Haars gebe schon einen andern
Ton. Diess ist indess vollkommen unrichtig. Denn selbst
eine auffallende Veränderung der Weite der Stimmritze hat, wenn
nur die gleiche Spannung der Stimmbänder gesichert ist, keine
Aenderung der Höhe. des Tons zur Folge. Liscovius Ansicht
[Theorie der Stimme. Leipz. 1814.) ist diese: die Stimmritze selbst
und ihre verschiedene Weite sey es, worauf es bei Entstehung
der Stimme und ihrer mannigfaltigen Höhe und Tiefe vorzüglich
ankomme. Indem die Luft mit einiger Gewalt und Schnelligkeit
durch diese enge Oeffnung hindurchdringt, werde sie dabei also
züsammengedrückt und erschüttert, dass alle ihre kleinsten Theil-
chen hin und Her bewegt werden. Etwas Aehnliches sehe man
in allen anderen Fällen, wo die Luft, durch irgend eine enge
Oeffnung hindurchgetrieben werde. Je grösser nun die Oeffnung
der Stimmritze sey,. desto tiefer der Ton, weil dadurch
grössere und folglich langsamere.Luftwellen entstehen.
Liscovius Ein würfe gegen das Tönen der Bänder selbst sind diese:
Nach ihm sollen die Stimmbänder bei tiefen Tönen angespannt, bei
hohen erschlafft werden. Denn bei" tiefen Tönen erweitere sich die
Stimmritze und ihre Bänder weichen auseinander. Sobald aber eine
Oeffnung bei unverletztem Zusammenhänge erweitert werde, müssen
nothwendig die Ränder der Oeffnung ausgedehnt werden. So
sey keine Erweiterung der Stimmritze möglich ohne- gleichzeitige
Anspannung der Stimmbänder, und folglich seyen die Stimmbänder
bei tiefen Tönen gespannt, bei hohen erschlafft. Diess ist
offenbar ein Missverständniss. Giebt man den Stimmbändern eine
bestimmte Spannung durch die früher beschriebene Vorrichtung,
so lässt sich bei gleicher Spannung die Weife der Stimmritze, ganz
beliebig verändern. Die Stimmritze kann sonst bei gespannten und
erschlafften Bändern sowohl weit als enge seyn. Dann bemerkt
Liscovius, dass nur trockne Saiten elastisch seyen; die Stimmbänder
aber seyen immer nass. Die Saite ist indess nur eine
bestimmte Species der fadenförmigen, durch Spannung elastischen
Körper. Diese Species verliert ihre Elasticität, wenn sie nass
ist. Das elastische Gewebe im menschlichen Körper ist hingegen
nur elastisch, wenn es nass ist, und verliert seine Elasticität, wenn
es trocken ist. Diess sind singuläre Verschiedenheiten, welche
die feststehenden Gesetze der fadenförmigen, durch Spannung
elastischen Körper nicht verändern.
Der Einwurf, dass die Stimmbänder als Bänder unmöglich
einen Umfang von Tönen und diese Tiefe haben könnten, ist
schon oben erledigt. Man hat sich bei dem Vergleich der Stimmbänder
mit Saiten pro und contra viel zu sehr an dieser Species
von fadenförmigen, durch Spannung elastischen Körpern aufgehalten
und ist dadurch auf Missverständnisse gekommen. Sub-
stituirt man den Darmsaiten mehr elastische Fäden von Kaut-
schuck oder thierischem elastischen Gewebe, so fällt alles Zufällige,
was uns gerade die Darmsaiten darbieten, weg.
M u lle r’s Physiologie. 2r Bd. I. 14