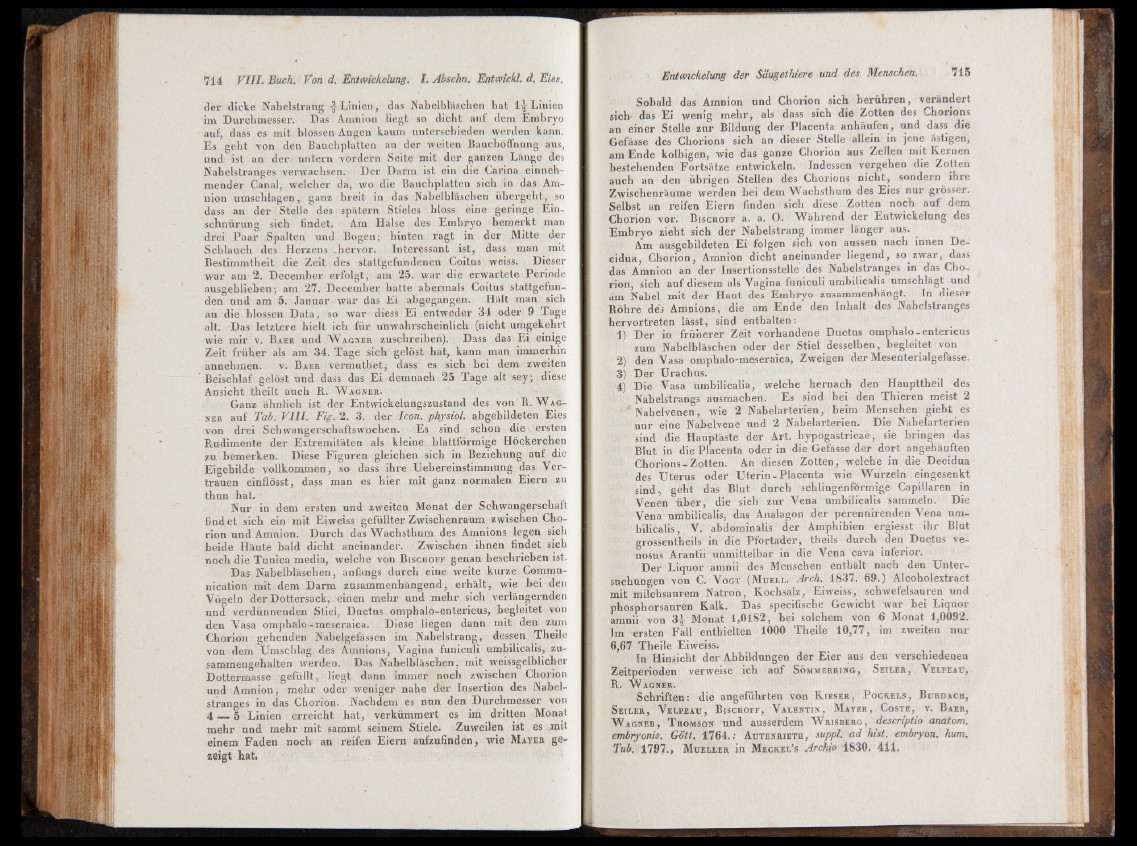
der dicke Nabelstrang Linien, das Nabelbläschen hat Linien
im Durchmesser. Das Amnion liegt so dicht auf dem Embryo
auf, dass es mit blossen Augen kaum unterschieden werden kann.
Es geht von den Bauchplatten an der weiten BauchöfFnung aus,
und ist an der untern vordern Seite mit der ganzen Länge des
Nabelstranges verwachsen. Der Darm ist ein die Carina einnehmender
Canal, welcher da, wo die Bauchplatten sich in das Amnion
Umschlägen, ganz breit in das Nabelbläschen übergeht, so
dass an der Stelle des spätem Stieles bloss eine geringe Einschnürung
sich findet. Am Halse des Embryo bemerkt man
drei Paar Spalten und Bogen; hinten ragt in der Mitte der
Schlauch des Herzens .hervor. Interessant ist, dass man mit
Bestimmtheit die Zeit des stattgefundenen Coitus weiss. Dieser
war am 2. December erfolgt, am 25. war die erwartete Periode
ausgehliehen; am 27. December hatte abermals Coitus stattgefunden
und am 5. Januar war das Ei abgegangen. Hält man sich
an die blossen Data, so war diess Ei entweder 34 oder 9 Tage
alt. Das letztere hielt ich für unwahrscheinlich (nicht umgekehrt
wie mir v. Baer und "Wagner zuschreiben). Dass das Ei einige
Zeit früher als am 34. Tage sich gelöst hat, kann man immerhin
annehmen. v. Baer vermufhet, dass es sich bei dem zweiten
Beischlaf gelöst und dass das Ei demnach 25 Tage alt sey; diese
Ansicht theilt auch R. W agner.
Ganz ähnlich ist der Entwickelungszustand des von R. W agner
auf Tab. VIII. Fig. 2. 3. der Icon, physiol. abgebildeten Eies
von drei Schwangerschaftswochen. Es sind schon die ersten
Rudimente der Extremitäten als kleine blattförmige Höckerchen
zu bemerken. Diese Figuren gleichen sich in Beziehung auf die
Eigebilde vollkommen, so dass ihre Uebereinstimmung das Vertrauen
einflösst, dass man es hier mit ganz normalen Eiern zu
thun hat. '
Nur in dem ersten und zweiten Monat der Schwangerschaft
findet sich ein mit Eiweiss gefüllter Zwischenraum zwischen Chorion
und Amnion. Durch das Wachsthum des Amnions legen sich
beide Häute bald dicht aneinander. Zwischen ihnen findet sich
noch die Tunica media, welche von Bischoff genau beschrieben ist.
Das Nabelbläschen, anfangs durch eine weite kurze Commu-
nication mit dem Darm zusammenhängend, erhält, wie bei den
Vögeln der Dottersack, einen mehr und mehr sich verlängernden
und verdünnenden Stiel, Ductus omphalo-entericus, begleitet von
den Vasa omphalo-meseraica. Diese liegen dann mit den zum
Chorion gehenden Nabelgefässen im Naheistrang, dessen Theile
von dem Umschlag des Amnions, Vagina funiculi umbilicalis, zu-
saramengehalten werden. Das Nabelbläschen, mit weissgelblicher
Dottermasse gefüllt, liegt dann immer noch zwischen Chorion
und Amnion, mehr oder weniger nahe der Insertion des Nabelstranges
in das Cborion. Nachdem es nun den Durchmesser von
4 _ 5 Linien erreicht hat, verkümmert es im dritten Monat
mehr und mehr mit sammt seinem Stiele. Zuweilen ist es mit
einem Faden noch an reifen Eiern aufzufinden, wie Mauer gezeigt
hat.
Sobald das Amnion und Chorion sich berühren, verändert
sich’ das Ei wenig mehr, als dass sich die Zotten des Chorions
an einer Stelle zur Bildung der Placenta anhäufen, und dass die
Gefässe des Chorions sich an dieser Stelle allein in jene ästigen,
am Ende kolbigen, wie das ganze Chorion aus Zellen mit Kernen
bestehenden Fortsätze entwickeln. Indessen vergehen die Zotten
auch an den übrigen Stellen des Chorions nicht, sondern ihre
Zwischenräume werden bei dem Wüchsthum des Eies nur grösser.
Selbst an reifen Eiern finden sich diese Zotten noch auf dem
Chorion vor. Bischoff a. a. O. Während der Entwickelung des
Embryo zieht sich der Naheistrang immer länger aus.
Am ausgebildeten Ei folgen sich von aussen nach innen Decidua,
Chorion, Amnion dicht aneinander liegend, so zwar, dass
das Amnion an der Insertionsstelle des Nabelstranges in das Chorion,
sich auf diesem als Vagina funiculi umbilicalis umschlägt und
am Nabel mit der Haut des Embryo zusammenhängt. In dieser
Röhre des Amnions, die am Ende den Inhalt des Nabelstranges
hervortreten lässt, sind enthalten:
1) Der in früherer Zeit vorhandene Ductus omphalo-entericus
zum Nabelbläschen oder der Stiel desselben, begleitet von
2) den Vasa ompbalo-meseraica, Zweigen der Mesenterialgefässe.
3) Der Urachus.
4) Die Vasa umbilicalia, welche hernach den Haupttheil des
Nabelstrangs ausmachen. Es sind bei den Thieren meist 2
' * Nabelvenen, wie 2 Nabelarterien, beim Menschen giebt es
nur eine Nabelvene und 2 Nabelarterien. Die Nabelarterien
sind die Hauptäste der Art. bypogastricae, sie bringen das
Blut in die Placenta oder in die Gefässe der dort angehäuften
Chorions-Zotten. An diesen Zotten, welche in die Decidua
des Uterus oder Uterin-Placenta wie Wurzeln eingesenkt
sind, geht das Blut durch schlingenförmige Capillaren in
Venen über, die sich zur Vena umbilicalis sammeln. Die
Vena umbilicalis, das Analagon der perennirenden Vena umbilicalis,
V. abdominalis der Amphibien ergiesst ihr Blut
grossentheils in die Pfortader, theils durch den Ductus ve-
nosus Arantii unmittelbar in die Vena cava inferior.
Der Liquor amnii des Menschen enthält nach den Untersuchungen
von C. Vogt (Muell. Arch. 1837. 69.) Alcoholextract
mit milchsaurem Natron, Kochsalz, Eiweiss, schwefelsauren und
phosphorsauren Kalk. Das specifische Gewicht war bei Liquor
amnii von 3^ Monat 1,0182, bei solchem von 6 Monat 1,0092.
Im ‘ersten Fall enthielten 1000 Theile 10,77, im zweiten nur
6,67 Theile Eiweiss.
In Hinsicht der Abbildungen der Eier aus den verschiedenen
Zeitperioden verweise ich auf Sömmerring, Seiler, V elpeau,
R. W agner.
Schriften: die angeführten von K ieser, P ockels, Burdach,
Seiler, V elpeau, Bischoff, Valentin, Mayer, Coste, v. Baer,
W agner, T homson und ausserdem W risberg, descriptio anatom,
embryonis. Gott. 1764.; Autenrieth, suppl. ad hist, embryon, hum.
Tub, 1797., Mueller in Meckel’s Archio 1830. 411.