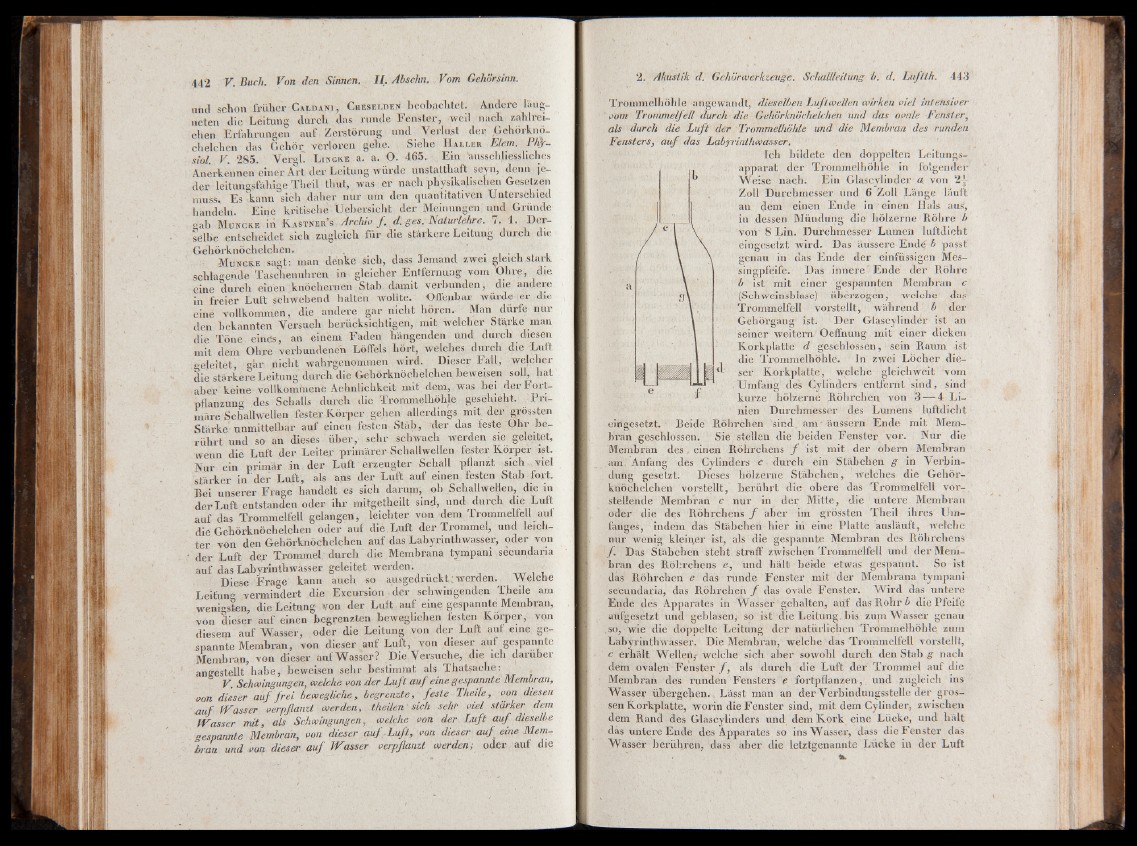
und schon früher Caldani, Chesei/den beobachtet. Andere leugneten
die Leitung durch das runde Fenster, weil nach zahlreichen
Erfahrungen auf Zerstörung und Verlust der Gehörknöchelchen
das Gehör verloren gehe. Siehe Haller Eiern. Phjr-
siol. V, 285. Vergb Lingke a. a. O. 465. Ein 'ausschliessliches
Anerkennen einer Art der Leitung würde unstatthaft seyn, denn jeder
leitungsfähige Theil thut, was er nach physikalischen Gesetzen
muss. Es kann sich daher nur um den quantitativen Unterschied
handeln. Eine kritische Übersicht der Meinungen und Gründe
gab Muncke in Kastner’s Archiv f . d. ges. Naturlehre. 7. 1. Derselbe
entscheidet sich zugleich für die stärkere Leitung durch die
Gehörknöchelchen. , ’ . .
Mungke sagt: man denke sich, dass Jemand zwei gleich stark
schlagende Taschenuhren in gleicher Entfernung vom Ohre, die
eine durch einen knöchernen Stab damit verbunden, die andere
in freier Luft schwebend halten wollte. Offenbar würde er die
eine vollkommen, die andere gar nicht hören. Man dürfe nur
den bekannten Versuch berücksichtigen, mit welcher Starke man
die Töne eines, an einem Faden hängenden und durch diesen
mit dem Ohre verbundenen Löffels hört, welches durch die -Luft
.geleitet, gar nicht wahrgenommen wird. Dieser Fäll, welcher
die stärkere Leitung durch die Gehörknöchelchen beweisen soll, hat
aber keine vollkommene Aehnlichkeit mit dem, was bei der Fortpflanzung
des Schalls durch die Trommelhöhle geschieht. Primäre
Schallwellen fester Körper gehen allerdings mit der grössten
Stärke unmittelbar auf einen festen Stäb,'der das feste Ohr berührt
und so an dieses über, sehr schwach werden sie geleitet,
wenn die Luft der Leiter primärer Schallwellen fester Körper ist.
Nur ein primär in der Lüft' erzeugter Schall pflanzt sich viel
stärker in der Luft, als aus der Luft auf einén festen Stab fort.
Bei unserer Frage handelt es sich darum, ob Schallwellen, die in
der Luft entstanden oder ihr mitgetheilt sind, und durch die Luft
auf das Trommelfell gelangen, leichter von dem Trommelfell auf
die Gehörknöchelchen oder auf dié. Luft der Trommel, und leichter
von den Gehörknöchelchen auf das Labyrinthwasser, oder von
• der Luft der Trommel durch die Membrana tympani secundaria
auf das Labyrinthwasser geleitet werden. __v y
Diese Frage' kann auch so ausgedrückt;werden. Welche
Leitung vermindert die Excursion dér schwingenden Tbeile am
wenigsten, die Leitung von der Luft • auf eine gespannte Membran,
von dieser auf einen begrenzten beweglichen festen Körper, vpn
diesem auf Wasser, oder die Leitung von der Luft auf eine gespannte
Membran, von dieser auf Luft, von dieser auf gespannte
Membran, von dieser auf Wasser? Die Versuche, die ich darüber
angestellt habe, beweisen sehr bestimmt als Thatsache:
V. Schwingungen, welche von der Luft auf eine gespannte Membran,
oon dieser auf frei bewegliche, begrenzte, feste Theile, von diesen
a u f Wasser verpflanzt werden, theilen 'sich sehr viel stärker dem
Wasser mit, als Schwingungen, welche von der Luft auf dieselbe
gespannte Membran, von dieser auf, Luft, von dieser auf eine Membran
und von dieser- auf Wasser verpflanzt werden; oder auf die
Trommelhöhle angewandt, dieselben Luftwellen wirken viel intensiver
vom Trommelfell durch die Gehörknöchelchen und das ovale Fenster,
als durch die Luft der Trommelhöhle und die Membran des runden
Fensters, auf das Labyrinthwasser.
Ich bildete den doppelten Leitungsapparat
der Trommelhöhle in folgender
Weise nach. Ein Glascylinder a von 2-J-
Zoll Durchmesser und 6 Zoll Länge läuft
an dem einen Ende in einen Hals aus,
in dessen Mündung die hölzerne Röhre b
von 8 Lin. Durchmesser Lumen luftdicht
eingesetzt wird. Das äussere Ende b passt
genau in das Ende der einfüssigen Messingpfeife.
Das innere'Ende der Röhre
b ist mit einer gespannten Membran c
(Schweinsblase) überzogen, welche das
Trommelfell vorstellt, während b der
Gehörgang ist. Der Glascylinder ist an
seiner weitern1 Oeffnung inif einer dicken
Korkplatte d geschlossen, ■ sein Raum ist
die Trommelhöhle. In zwei Löcher dieser
Korkplatte, welche gleichweit vom
„ i Umfang des Gylinders entfernt smd, sind
® kurze hölzerné Röhrchen von 3 — 4 Linien
Durchmesser des Lumens luftdicht
eirigesetzt. Beide Röhrchen sind am äussern Ende mit Membran
geschlossen. Sie stellen die beiden Fenster vor. Nur die
Membran des , einen Röhrchens ƒ ist mit der obern Membran
am, Anfang des Cylinders c durch ein Stäbchen g in Verbindung
gesetzt. Dieses hölzerne Stäbchen, welches die Gehörknöchelchen
vorstellt, berührt die obere das Trommelfell vor-,
stellende Membran c nur in der Mitte, die untere Membran
oder die des Röhrchens ƒ aber im grössten Theil ihres Umfanges,
indem das .Stäbchen hier in eine Platte ausläuft, welche
nur wenig kleiner ist, als die gespannte Membran des Röhrchens
ƒ. D as Stäbchen steht straff zwischen Trommelfell und der Membran
des Röhrchens e, und hält beide etwas gespannt. So ist
das Röhrchen e das runde Fenster mit der Membrana tympani
secundaria, das Röhrchen ƒ das ovale Fenster, Wird das untere
Ende dés Apparates in WaSser'gehalten, auf das Rohr b die Pfeife
aufgesetzt und geblasen^ so ist die Leitung, bis zum Wasser genau
so, wie die doppelte Leitung der natürlichen Trommelhöhle zum
Labyrinthwasser. Die Metnbran, welche das Trommelfell vorstellt,
c erhält Wellen,« welche sich aber sowohl durch den Stab g nach
dem ovalen Fenster/, als durch die Luft der Trommel auf die
Membran des runden Fensters e fortpflanzen, und zugleich ins
Wässer übergehen. Lässt man an der Verbindungsstelle der grossen
Korkplatte, worin die Fenster sind, mit dem Cylinder, zwischen
dem Rand des Glascylinders und dem Kork eine Lücke, und hält
das untere Ende des Apparates so ins Wasser, dass die Fenster das
Wasser berühren, dass aber die letztgenannte Lücke in der Luft