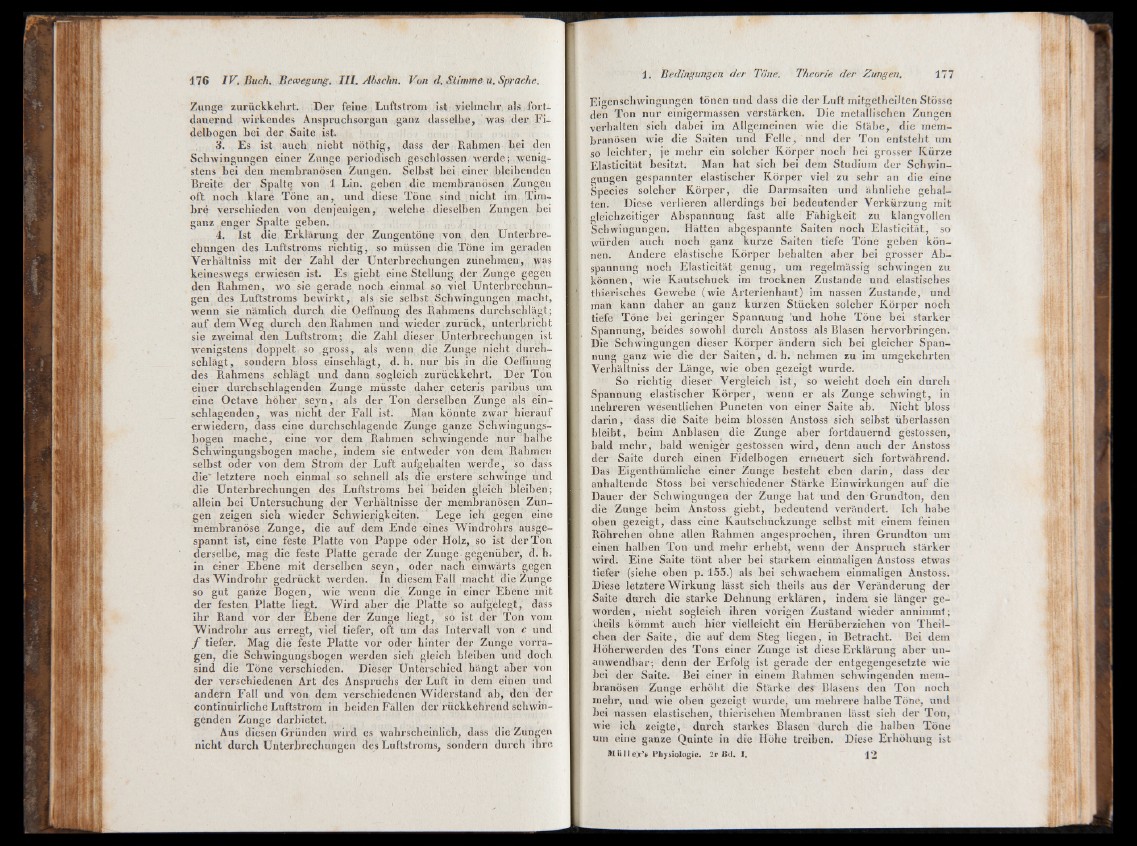
Zunge zurückkehrt. Der feine Luftstrom ist /vielmehr a]s fortdauernd
wirkendes Anspruchsorgan ganz dasselbe, was der Fidelbogen
bei der Saite ist.
3. Es ist auch nicht nöthig, dass der Rahmen bei den
Schwingungen einer Zunge, periodisch geschlossen werde; wenigstens
bei den membranösen Zungen. Selbst bei einer bleibenden
Rreite der Spalte von 1 Lin. geben die membranösen Zungen
oft noch klare Töne an, und diese Töne sind nicht im Timbré
verschieden von denjenigen, welche dieselben Zungen bei
ganz enger Spalte geben.
4. Ist die Erklärung der Zungentöne von den Unterbrechungen
des Luftstroms richtig, so müssen die Töne im geraden
Verhältniss mit der Zahl der Unterbrechungen zunehmen, ! was
keineswegs erwiesen ist. Es gi’ebt eine Stellung der Zunge gegen
den Rahmen, wo sie gerade noch-einmal so viel Unterbrechungen
des Luftstroms bewirkt, als sie selbst Schwingungen macht,
wenn sie nämlich durch die Oeffnung des Rahmens durchschlägt;
auf dem Weg durch den Rahmen und wieder zurück, unterbricht
sie zweimal den Luftstrom; die Zahl dieser Unterbrechungen ist
wenigstens doppelt so gross, als wenn die, Zunge nicht durchschlägt,
sondern bloss einschlägt, d. h. nur bis in die Oeffnung
des Rahmens schlägt und dann sogleich zurückkehrt. Der Ton
einer durchschlagenden Zunge müsste daher ceteris paribus um
eine Octave höher seyn, als der Ton derselben Zunge als einschlagenden
, was nicht der Fall ist. Man könnte zwar hierauf
erwiedern, dass eine durchschlagende Zunge ganze Schwingungs-
Logen mache, eine vor dem Rahmen schwin8ende nur halbe
Schwingungsbogen mache, indem sie entweder von dem Rahmen
selbst oder von dem Strom der Luft aufgehaiten werde, so dass
die'letztere noch einmal so schnell als die erstere schwinge und
die Unterbrechungen des Luftstroms bei beiden gleich bleiben;
allein bei Untersuchung der Verhältnisse der membranösen Zungen
zeigen sich wieder Schwierigkeiten. Lege ich gegen eine
membranöse Zunge, die auf dem Ende eines Windrohrs ausgespannt
ist, eine feste Platte von Pappe oder Holz, so ist der Ton
derselbe, mag die feste Platte gerade der Zunge gegenüber, d. h.
in einer Ebene mit derselben seyn, oder nach einwärts gegen
das Windrohr gedrückt werden. In diesem Fall macht die Zunge
so gut ganze Bogen, wie wenn die Zunge in einer Ebene mit
der festen Platte liegt. Wird aber die Platte so aufgelegt, dass
ihr Rand vor der Ebene der Zunge liegt, so ist der Tön vom
Windrohr aus erregt, viel tiefer, oft um das Intervall von c und
f tiefer. Mag die feste Platte vor oder hinter der Zunge vörra-
gen, die Schwingungsbogen werden sich gleich bleiben und doch
sind die Töne verschieden. Dieser Unterschied hängt aber von
der verschiedenen Art des Anspruchs der Luft in dem einen und
andern Fall und von dem verschiedenen Widerstand ab, den der
continuirliche Luftstrom in beiden Fällen der rückkehrend schwingenden
Zunge darbietet.
Aus diesen Gründen wird es wahrscheinlich, dass die Zungen
nicht durch Unterbrechungen des Luftstroms, sondern durch ihre
Eigenschwingungen tönen und dass die der Luft mitgetheilten Stösse
den Ton nur einigermassen verstärken. Die metallischen Zungen
verhalten sich dabei im Allgemeinen wie die Stäbe, die membranösen
wie die Saiten und Felle, nnd der Ton entsteht um
so leichter, je mehr ein solcher Körper noch bei grosser Kürze
Elasticität besitzt; Man hat sich bei dem Studium der Schwingungen
gespannter elastischer Körper viel zu sehr an die eine
Species solcher Körper, die Darmsaiten und ähnliche gehalten.
Diese verlieren allerdings bei bedeutender Verkürzung mit
gleichzeitiger Abspannung fast alle Fähigkeit zu klangvollen
Schwingungen. Hätten abgespannte Saiten noch Elasticität, so
würden auch noch ganz kurze Saiten tiefe Töne geben können.
Andere elastische Körper behalten aber bei grosser Abspannung
noch Elasticität genug, um regelmässig schwingen zu
können, wie Kautschuck im trocknen Zustande und elastisches
thierisches Gewebe (wie Arterienhaut) im nassen Zustande, und
man kann daher an ganz kürzen Stücken solcher Körper noch
tiefe Töne bei geringer Spannung !und hohe Töne bei starker
Spannung, beides sowohl durch Anstoss als Blasen hervorbringen.
Die Schwingungen dieser Körper ändern sich bei gleicher Spannung
ganz wie die der Saiten, d. h. nehmen zu im umgekehrten
Verhältniss der Länge, wie oben gezeigt wurde.
So richtig dieser Vergleich ist, so weicht doch ein durch
Spannung elastischer Körper, wenn er als Zunge schwingt, in
mehreren wesentlichen Puncten von einer Saite ab. Wicht bloss
darin, dass die Saite beim blossen Anstoss sich selbst überlassen
bleibt, beim Anblasen die Zunge aber fortdauernd gestossen,
bald mehr, bald weniger gestossen wird, denn auch der Anstoss
der Saite durch einen Fidelbogen erneuert sich fortwährend.
Das Eigenthümliche einer Zunge besteht eben darin, dass der
anhaltende Stoss bei verschiedener Stärke Einwirkungen auf die
Dauer der Schwingungen der Zunge hat und den Grundton, den
die Zunge beim Anstoss giebt, bedeutend verändert. Ich habe
oben gezeigt, dass eine Kautscbuckzunge selbst mit einem feinen
Röhrchen ohne allen Rahmen angesprochen, ihren Grundton um
einen halben Ton und mehr erhebt, wenn der Anspruch stärker
wird. Eine Saite tönt aber bei starkem einmaligen Anstoss etwas
tiefer (siehe oben p. 155.) als bei schwachem einmaligen Anstoss.
Diese letztere Wirkung lässt sich theils aus der Veränderung der
Saite durch die starke Dehnung erklären, indem sie länger geworden
, nicht sogleich ihren vorigen Zustand wieder annirnmf;
iheils kömmt auch hier vielleicht ein Herüberziehen von Theil-
chen der Saite, die auf dem Steg liegen, in Betracht. Bei dem
Höherwerden des Tons einer Zunge ist diese Erklärung aber unanwendbar;
denn der Erfolg ist gerade der entgegengesetzte wie
bei der Saite. Bei einer in einem Rahmen schwingenden membranösen
Zunge erhöht die Stärke des' Blasens den Ton noch
mehr, und wie oben gezeigt wurde, um mehrere halbe Töne, und
bei nassen elastischen, thierischen Membranen lässt sich der Ton,
wie ich zeigte, durch starkes Blasen durch die halben Töne
um eine ganze Quinte in die Höhe treiben. Diese Erhöhung ist
W ii 11 Physiologie. 2r Bd. I. j 2