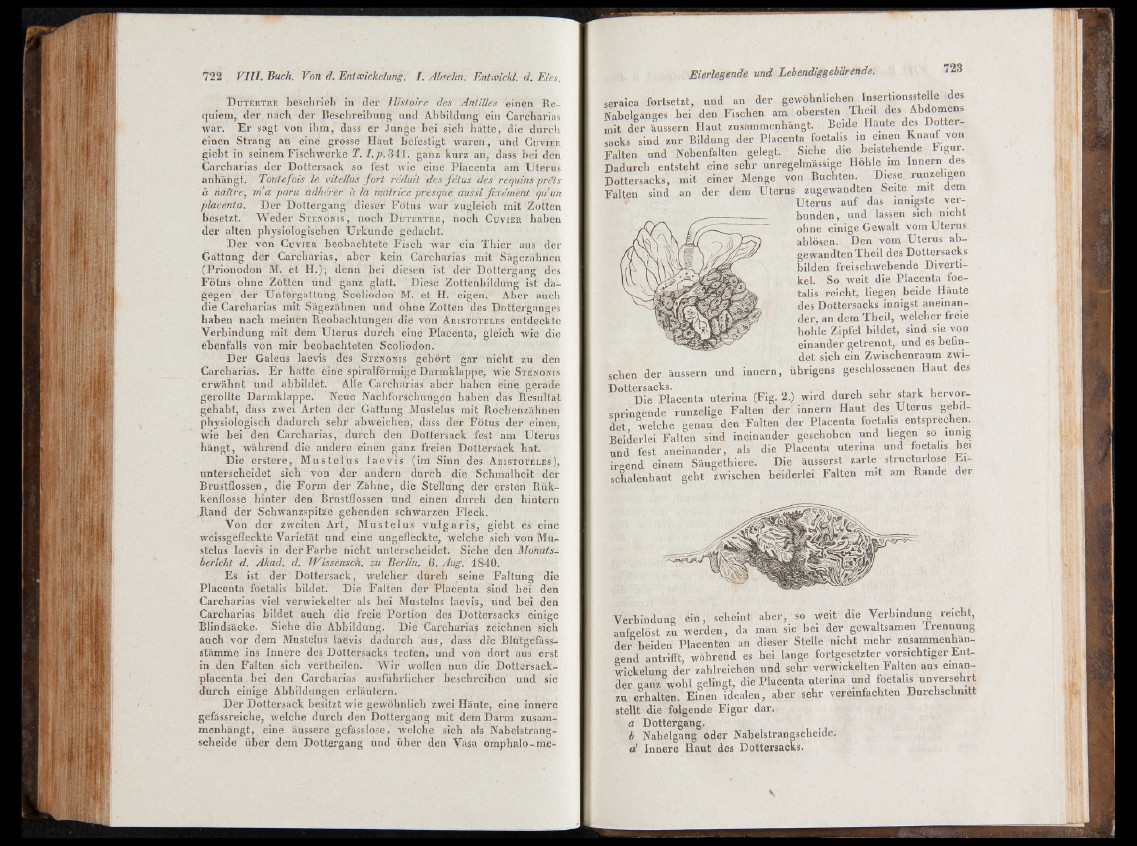
D utertre beschrieb in der Histoire des Antilles einen Requiem,
der nach der Beschreibung und Abbildung ein Carcharias
war. Er sagt von ihm, dass er Junge bei sich batte, die durch
einen Strang an eine grosse Haut befestigt waren, und Cuvier
giebt in seinem Fischwerke T .I.p . 341. ganz kurz an, dass bei den
Carcharias der Dottersack so fest wie eine Placenta am Uterus
anhängt. Toutefois le oiteïlus fort réduit des fétus des requins prêts
à naître, m a paru adhérer à la matrice presque aussi fixément qu’un
placenta. Der Dottergang dieser Fötus War zugleich mit Zotten
besetzt. Weder Stenonis, noch D utertre, noch Cuvier haben
der alten physiologischen Urkunde gedacht.
Der von Cuvier beobachtete Fisch war ein Thier aus der
Gattung der Carcharias, aber kein Carcharias mit Sägezähnen
(Prionodon M. èt H.); denn bei Riesen ist der Dottergang des
Fötus ohne Zotten und ganz glatt. Dièse Zottenbildung ist dagegen
der Untergattung Scoliodon M. et H. eigen. Aber auch
die Carcharias mit Sägezähnen und ohne Zotten des Dotterganges
haben nach meinen Reobachtungén die von Aristoteles entdeckte
Verbindung mit dem Uterus durch eine Placenta, gleich wie die
ebenfalls von mir beobachteten Scoliodon.
Der Galeus laevis des Stenonis gehört gar nicht zu den
Carcharias. Er hatte eine spiralförmige Darmklappej wie StEnonis
erwähnt und abbildet. Alle Carcharias aber haben eine gerade
gerollte Darmklappe. Neue Nachforschungen haben däs Resultat
gehabt, dass zwei Arten der Gattung Mustelus mit Rochenzähnen
physiologisch dadurch Sehr abweichen, dass der Fötus der einen,
wie bei den Carcharias, durch den Dottersack fest am Uterus
hängt, während die andere einen ganz freien Dottersäck hat.
Die erstere, Mustelus laevis (im Sinn des Aristoteles),
unterscheidet sich von der andern durch die Schmalheit der
Brustflossen, die Form der Zähne, die Stellung der ersten Rük-
kenflossë hinter den Brustflossen und einen durch den hintern
Rand der Schwanzspitze gehenden schwarzen Fleck.
Von der zweiten Art, Mustelus v u lg a ris, giebt es eine
weissgefleckte Varietät und eine ungeflèckte, Welche sich von Mustelus
laevis in der Farbe nicht unterscheidet. Siehe Aen Monatsbericht
d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 6. Aug. 1840.
Es ist der Dottersack, welcher durch seine Faltung die
Placenta foetalis bildet. Die Falten der Placenta sind bei den
Carcharias viel verwickelter als bei Mustelus laevis, und bei den
Carcharias bildet auch die freie Portion des Dottersacks einige
Blindsäcke. Siehe die Abbildung. Die Carcharias zeichnen sich
auch vor dem Mustelus laevis dadurch aus, dass die Blütgefäss-
stämme ins Innere des Dottersacks treten, und von dort aus erst
in den Falten sich vertheilen. Wir wollen nun die Dottarsack-
placenta bei den Carcharias ausführlicher beschreiben und sie
durch einige Abbildungen erläutern.
Der Dottersack besitzt wie gewöhnlich zwei Häute, eine innere
gefässreiche, welche durch den Dottergang mit dem Darm zusammenhängt,
eine äussere gefässlose, Welche sich als Nabelstrangscheide
über dem Dottergang und über den Vasa omphalo-meseraica
fortsetzt, und an der gewöhnlichen Insertionssteile des
Nabelganges bei den Fischen am obersten Theil des Abdomens
mit der äussern Haut zusammenhängt. Beide Haute des Dottersacks
sind zur Bildung der Placenta foetalis in einen Knauf von
Falten und Nebenfalten gelegt. Siehe die beistehende Figur.
Dadurch entsteht eine sehr unregelmässige Hohle im Innern d s
Dottersacks, mit einer Menge von Buchten. Diese., runzeligen
Falten sind an der dem Uterus zugewandten Seite mit dem
Uterus auf das innigste verbunden,
und lassen sich nicht
ohne einige Gewalt vom Uterus
ablösen. Den vom Uterus abgewandten
Theil des Dottersacks
bilden freischwebende Divertikel.
So weit die Placenta foetalis
reicht, liegen beide Häute
des Dottersacks innigst aneinander,
an dem Theil, welcher freie
hohle Zipfel bildet, sind sie von
einander getrennt, und es befindet
sich ein Zwischenraum zwischen
der äussern und innern, übrigens geschlossenen Haut des
Dottersacks. . , j , . . , ,
Die Placenta uterina (Fig. 2.) wird durch sehr stark hervoi-
springende runzelige Falten der innern Haut des Uterus gebildet
welche genau den Falten der Placenta foetalis entsprechen.
Beiderlei Falten sind ineinander geschoben und liegen so innig
und fest aneinander, als die Placenta uterina und foetalis bei
irgend einem Säugethiere. Die äusserst zarte structurlose Ei-
schalenhaut geht zwischen beiderlei Falten mit am Rande der
Verbindung ein, scheint aber, so weit die Verbindung reicht,
aufgelöst zu werden, da man sie bei der gewaltsamen Trennung
der beiden Placenten an dieser Stelle nicht mehr zusammenhängend
antrilft, während es bei lange fortgesetzter vorsichtiger Entwickelung
der zahlreichen und sehr verwickelten Falten aus einander
ganz wohl gelingt, die Placenta uterina und foetalis unversehrt
zu erhalten. Einen idealen, aber sehr vereinfachten Durchschnitt
stellt die folgende Figur dar.
a Dottergang.
b Nabelgang oder Naheistrangscheide.
a! Innere Haut des Dottersacks.