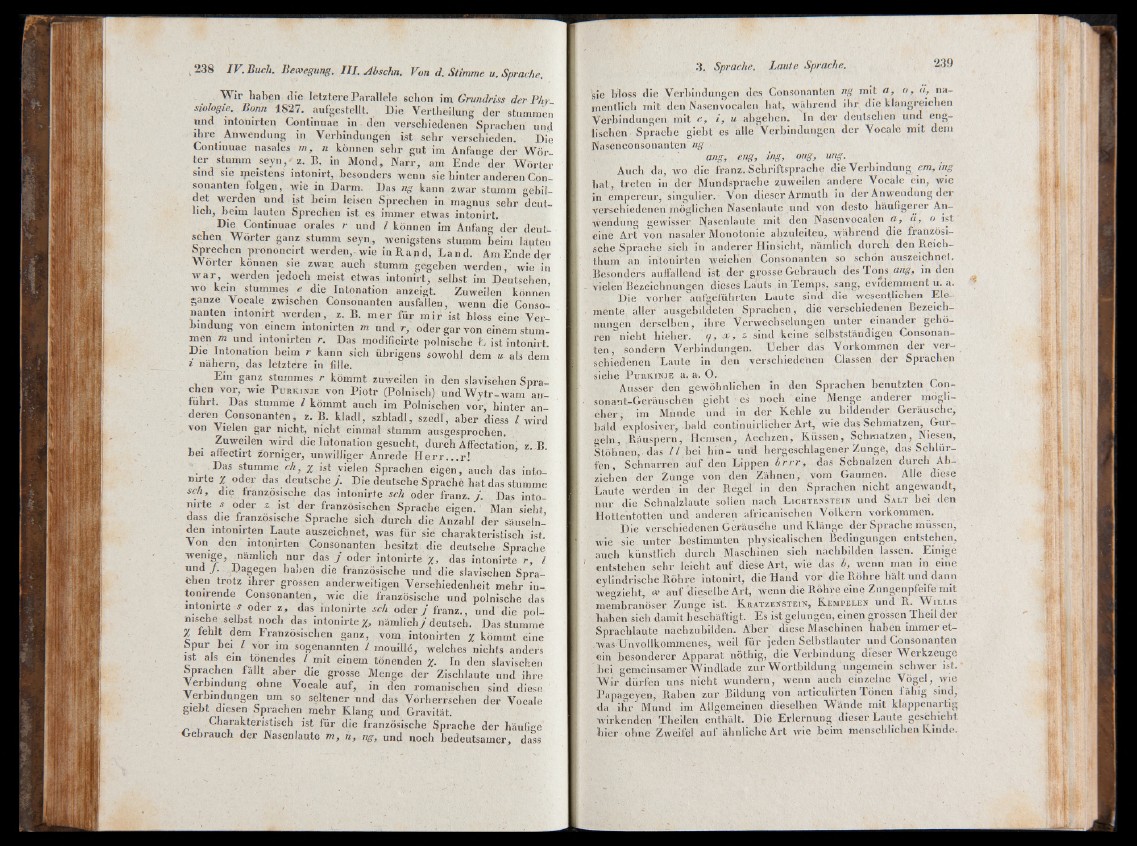
Wir haben tlie letztere Parallele schon im Grundriss der Phy
siologie. Bonn 1827. aufgestellt. Die Verkeilung der stummen
und mtomrten Continuae in den verschiedenen Sprachen und
ihre Anwendung in Verbindungen ist sehr verschieden. Die
Continuae nasales m, n können sehr gut im Anfänge der Wörter
stumm seyn,- z. B. in Mond, Narr, am Ende der Wörter
sind sie rpeistens intonirt, besonders wenn sie hinter anderen Consonanten
folgen, wie in Darm. Das ng kann zwar stumm gebil-
det werden und ist beim leisen Sprechen in magnus sehr deut-
lieh, beim lauten Sprechen ist es immer etwas intonirt.
Die Continuae orales r und l können im Anfang der deutschen
Wörter ganz stumm seyn, wenigstens stumm beim läuten
Sprechen prononcirt werden,-wie in Rand, Land. Am Ende der
Wörter können sie zwar, auch stumm gegeben werden, wie in
w a r, werden jedoch meist etwas intonirt, seihst im Deutschen,
wo kein stummes e die Intonation anzeigt. Zuweilen können
ganze Vocale zwischen Consonanten ausfallen, wenn die Consonanten
intonirt werden, ^ z. B. mer für mir ist bloss eine Verbindung
von einem intonirten m und r, oder gar von einem stummen
m und intonirten r. Das modificirte polnische f ist intonirt.
Die Intonation beim r kann sich übrigens sowohl dem u als dem
i nähern, das letztère in fiile.
Ein ganz stummes r kömmt zuweilen in den slavisehen Sprachen
vor, wie P urkinje von Piotr (Polnisch) und Wytr-warn anfuhrt.
Das stumme / kömmt auch im Polnischen vor, hinter an-
deren Consonanten, z. B. kladl, szbladl, szedf, aber diess /wird
von Vielen gar nicht, nicht einmal stumm ausgesprochen.
Zuweilen wird die Intonation gesucht, durch Affectation, z. B.
bei aifectirt zorniger, unwilliger Anrede H e rr...r!
Das stumme ch, % ist vielen Sprachen eigen, auch das into-
mrte X oder das deutsche/. Die deutsche Sprachè hat das stumme
sch, die französische das intonirte sch oder franz. j. Das into-
nirte s oder z ist der französischen Sprache eigen. Man sieht
dass die französische Sprache sich durch die Anzahl der säuselnden
intonirten Laute auszeichnet, was für sie charakteristisch ist.
Von den intonirten Consonanten besitzt die deutsche Sprache
wenige, nämlich nur das j oder intonirte x, das intonirte r, l
und / . Dagegen haben die französische und die slavisehen Sprachen
trotz ihrer grossen anderweitigen Verschiedenheit mehr intonerende
Consonanten, wie die französische und polnische das
intonirte s oder z, das intonirte sch oder j franz., und die pol-
msche selbst noch das intonirte %, nämlich j deutsch. Das stumme
X fehlt dem Französischen ganz, vom intonirten X kömmt eine
Spur bei / vor im sogenannten / mouillé, welches nichts anders
ist als ein tönendes / mit einem tönenden X■ f i den slavisehen
Sprachen fällt aber die grosse Menge der Zischlaute und ihre
Verbindung ohne Vocale auf, in den romanischen sind diese
Verbindungen um so seltener und das Vorherrschen der Vocale
giebt diesen Sprachen mehr Klang und Gravität.
Charakteristisch ist für die französische Sprache der häufige
Gebrauch der Nasenlaute m, n, ng, und noch bedeutsamer, dass
sie bloss die Verbindungen des Consonanten ng mit o, o, ii, namentlich
mit den Nasenvocalen hat, während ihr die klangreichen
Verbindungen mit e, i, u abgehen. In der deutschen und englischen
Sprache giebt es alle Verbindungen der Vocale mit dem
Nasenconsonanten ng •
cmg9 cti^ 9 9 OTiß9 uTi£f,
Auch da, wo die franz. Schriftsprache die Verbindung em,ing
hat, treten in der Mundsprache zuweilen andere Vocale ein, wie
in empereur, singulier. Von dieser Armuth in der Anwendung der
verschiedenen möglichen Nasenlaute und von desto häufigerer Anwendung
gewisser Nasenlaute mit den Nasenvocalen a, ä, o ist
eine Art von nasaler Monotonie abzuleiteq, während die französische
Sprache sich in anderer Hinsicht, nämlich durch den Reichthum
an intonirten weichen Consonanten so schön auszeichnet.
Besonders auffallend ist der grosse Gebrauch des Tons ang, in den
vielen Bezeichnungen dieses Lauts in Temps, sang, evidemrnent u. a.
Die .vorher aufgelührten Laute sind die wesentlichen Elemente
aller ausgebildeten Sprachen, die verschiedenen Bezeichnungen
derselben, ihre Verwechselungen iinter einander gehören
nicht Lieber. </, -x,' z sind keine selbstständigen Consonanten,
sondern Verbindungen. Ueber das Vorkommen der verschiedenen
Laute in den verschiedenen Classen der Sprachen
siehe Purkinje a. a. O.
Ausser den gewöhnlichen in den Sprachen benutzten Cop-
sonant-Geräuschen giebt ■ es noch eine Menge anderer möglicher,
im Munde und in der Kehle zu bildender Geräusche,
bäht explosiver, bald continuirlicher Art, wie das Schmatzen, Gurgeln,
.Räuspern, Hemsen, Aechzen, Küssen, Schmatzen, Niesen,
Stöhnen,, das / / hei hin- und hergeschlagener Zunge, das Schlürfen,
Schnarren auf den Lippen hrrr, das Schnalzen durch Abziehen
der Zunge von den Zähnen, vom Gaumen. Alle diese
Laute werden in der Regel in den Sprachen nicht angewandt,
nur die Schnalzlaute sollen nach L ichtenstein und Salt bei den
Hottentotten und anderen africanischen Völkern Vorkommen.
Die verschiedenen Geräusche und Klänge der Sprache müssen,
wie sie. unter bestimmten physicalischen Bedingungen entstehen,
auch künstlich durch Maschinen sich nachbilden lassen. Einige
entstehen sehr leicht auf diese Art, wie das l, wenn man in eine
cylindrische Röhre intonirt, die Hand vor die Röhre hält und dann
wegzieht, w auf dieselbe Art, wenn die Rohre eine Zungenpfeife mit
membranöser Zunge ist. Kratzenstein, K empelen und R. W illis
haben sich damit beschäftigt. Es ist gelungen, einen grossen Theil der
Sprach laute nacbzubilden. Aber diese Maschinen haben immer etwas
Unvollkommenes,. weil für jeden Selbstlauter und Consonanten
ein besonderer Apparat nöthig, die Verbindung dieser Werkzeuge
bei gemeinsamer Windlade zur Wortbildung ungemein schwer ist.
Wir dürfen uns nicht wundern, wenn auch einzelne Vögel, wie
Papageyen, Raben zur Bildung von articulirten Tönen fähig sind,
da ihr Mund im Allgemeinen dieselben Wände mit klappenartig
wirkenden Theilen enthält. Die Erlernung dieser Laute geschieht
hier ohne Zweifel aul ähnliche Art wie beim menschlichen Kinde.