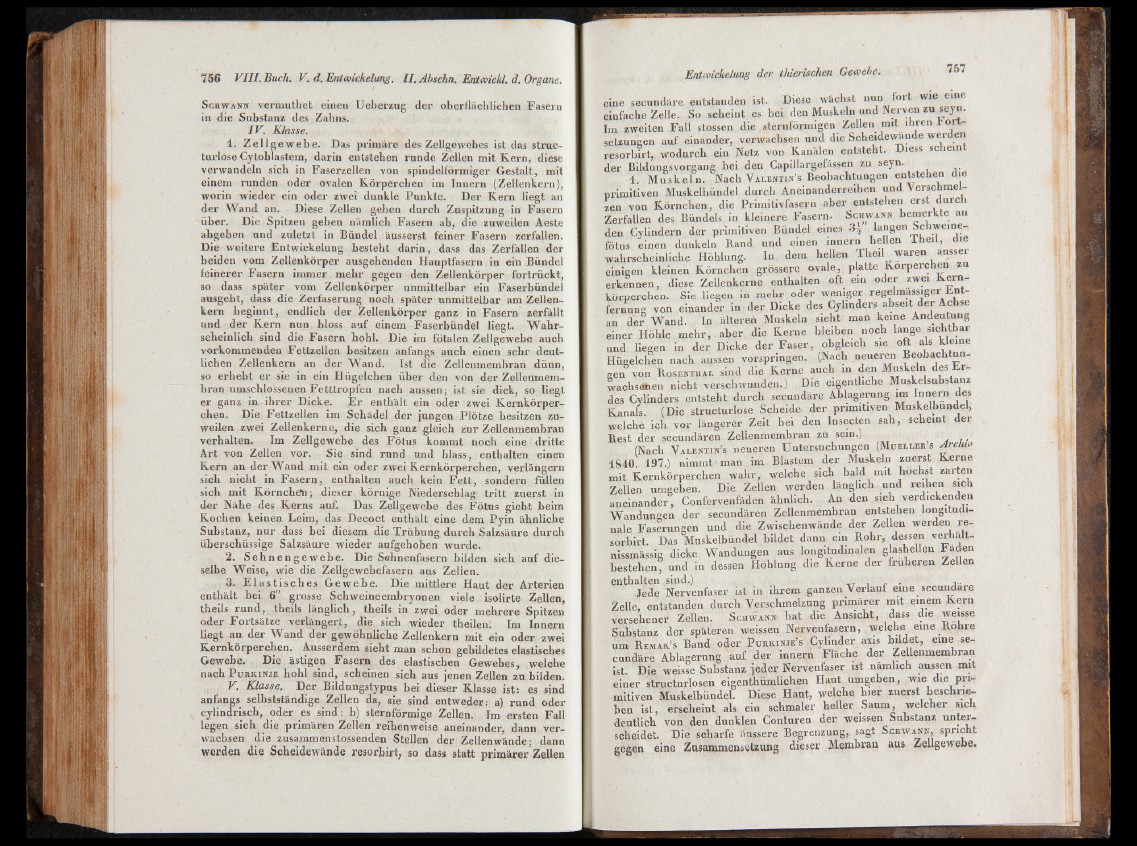
S c h w a n n vermuthet einen Ueberzug der oberflächlichen Fasern
in die Snbstanz des Zahns.
IV. Klasse.
1. Zellgewebe. Das primäre des Zellgewebes ist das struc-
tnrlose Cytoblastem, darin entstehen rnnde Zellen mit Kern, diese
verwandeln sich in Faserzellen von spindelförmiger Gestalt, mit
einem runden oder ovalen Körperchen im Innern (Zellenkern),
worin wieder ein oder zwei dunkle Punkte. Der Kern liegt an
der Wand an. Diese Zellen gehen durch Zuspitzung in Fasern
über. Die Spitzen geben nämlich Fasern ab, die zuweilen Aeste
abgeben und zuletzt in Bündel äusserst feiner Fasern zerfallen.
Die weitere Entwickelung besteht darin, dass das Zerfallen der
beiden vom Zellenkörper ausgehenden Hauptfasern in ein Bündel
feinerer Fasern immer mehr gegen den Zellenkörper fortrückt,
so dass später vom Zellenkörper unmittelbar ein Faserbündel
ausgeht, dass die Zerfaserung noch später unmittelbar am Zellenkern
beginnt, endlich der Zellenkörper ganz in Fasern zerfällt
und der Kern nun bloss auf einem Faserbündel liegt. Wahrscheinlich
sind die Fasern hohl. Die im fötalen Zellgewebe auch
vorkommenden Fettzellen besitzen anfangs auch einen sehr deutlichen
Zellenkern an der Wand. Ist die Zellenmembran dünn,
so erbebt er sie in ein Hügelchen über den von der Zellenmembran
umschlossenen Fetttropfen nach aussen; ist sie dick, so liegt
er ganz in ihrer Dicke. Er enthält ein oder zwei Kernkörperchen.
Die Fettzellen im Schädel der jungen Plötze besitzen zuweilen
zwei Zellenkerne, die sich ganz gleich zur Zellenmembran
verhalten. Im Zellgewebe des Fötus kommt noch eine dritte
Art von Zellen vor. Sie sind rund und blass, enthalten einen
Kern an der Wand mit ein oder zwei Kernkörperchen, verlängern
sich nicht in Fasern, enthalten auch kein Fett, sondern füllen
sich mit Körnchen; dieser körnige Niederschlag tritt zuerst in
der Nähe des Kerns auf. Das Zellgewebe des Fötus giebt beim
Kochen keinen Leim, das Decoct enthält eine dem Pyin ähnliche
Substanz, nur dass bei diesem die Trübung durch Salzsäure durch
überschüssige Salzsäure wieder aufgehoben wurde.
2. S ehnengewebe. Die Sehnenfasern bilden sich auf dieselbe
Weise, wie die Zellgewebefasern aus Zellen.
3. E la s tis c h e s G e w e b e. Die mittlere Haut der Arterien
enthält bei 6” grosse Schweineembryonen viele isolirte Zellen,
theils rund, theils länglich, theils in zwei oder mehrere Spitzen
oder Fortsätze verlängert, die sich wieder theilen. Im Innern
liegt an der Wand der gewöhnliche Zellenkern mit ein oder zwei
Kernkörperchen. Ausserdem sieht man schon gebildetes elastisches
Gewebe. Die ästigen Fasern des elastischen Gewebes, welche
nach P u r k in j e hohl sind, scheinen sich aus jenen Zellen zu bilden.
V. Klasse. Der Bildungstypus bei dieser Klasse ist: es sind
anfangs selbstständige Zellen da, sie sind entweder: a) rund oder
cylindrisch, oder es sind: b) sternförmige Zellen. Im ersten Fall
legen sich die primären Zellen reihenweise aneinander, dann verwachsen
die zusammenstossenden Stellen der Zellenwände; dann
werden die Scheidewände resorbirt, so dass statt primärer’Zellen
eine secundäre entstanden ist. Diese wächst nun fort wie eine
einfache Zelle. So scheint es bei den Muskeln und Nerven zuAeyn.
Im zweiten Fall stossen die sternförmigen Zellen mit ihren Bor
Setzungen auf einander, verwachsen und die Scheidewände werden
resorbirt, wodurch ein Netz von Kanälen entsteht. Diess schein
der Bildungsvorgang bei den Capillargefässen zu seyn.,
1. Muskeln. Nach V a l e n t in s Beobachtungen entstehen die
primitiven Muskelbündel durch Aneinanderreihen und Verschmelzen
von Körnchen, die Primitivfasern aber entstehen erst durch
Zerfallen des Bündels in kleinere Fasern. S c h w a n n bemerkte an
den Cylindern der primitiven Bündel eines 3 | langen Schweinefötus
einen dunkeln Rand und einen innern hellen iheil, die
wahrscheinliche Höhlung. In dem hellen Theil waren ausser
einigen kleinen Körnchen grössere ovale, platte Körperchen zu
erkennen, diese Zellenkerne enthalten oft em oder zwei Kern-
körperchen. Sie liegen in mehr oder weniger regelmassiger En -
fernung von einander in der Dicke des Cylinders abseit der Achse
an der Wand. In älteren Muskeln sieht man keine Andeutung
einer Höhle mehr, aber die Kerne bleiben noch lange sichtbar
und liegen in der Dicke der Faser, obgleich sie oft als kleine
Hügelchen nach aussen vorspringen. (Nach neueren Beobachtungen
von R o s e n t h a l sind die Kerne auch in den Muskeln des Er-
wachselnen nicht verschwunden,) Die eigentliche Muskelsubstanz
des Cylinders entsteht durch secundäre Ablagerung im Innern des
Kanals. (Die structurlose Scheide der primitiven Muskelbundel,
welche ich vor längerer Zeit hei den Insecten sah, scheint der
Rest der secundären Zellenmembran zu sein.) ,
(Nach V a l e n t in s neueren Untersuchungen (M u e l l e r s A rchiv
1840. 197.) nimmt-man im Blastem der Muskeln zuerst Kerne
mit Kernkörperchen wahr, welche sich bald mit höchst zarten
Zellen umgeben. Die Zellen werden länglich und reihen sich
aneinander, Confervenfäden ähnlich. An den sich verdickenden
Wandungen der secundären Zellenmembran entstehen longitudinale
Faserungen und die Zwischenwände der Zellen werden resorbirt.
Das Muskelbündel bildet dann ein Rohr, dessen verhalt-
nissmässig dicke Wandungen aus longitudinalen glashellen Faden
bestehen, und in dessen Höhlung die Kerne der früheren Zellen
enthalten sind.) , T . „ .
Jede Nervenfaser ist in ihrem ganzen Verlauf eine secundäre
Zelle, entstanden durch Verschmelzung primärer mit einem Kern
versehener Zellen. S c h w a n n hat die Ansicht, dass die weisse
Substanz der späteren weissen Nervenfasern, welche eine Rohre
um R em a k ’s Band oder P u r k in j e ’s Cylinder axis bildet, eine secundäre
Ablagerung auf der innern Fläche der Zellenmembran
ist. Die weisse Substanz jeder Nervenfaser ist nämlich aussen mit
einer structurlosen eigentümlichen Haut umgeben, wie die primitiven
Muskelbündel. Diese Haut, welche hier zuerst beschrieben
ist, erscheint als ein schmaler heller Saum, welcher sich
deutlich von den dunklen Conturen der weissen Substanz unterscheidet.
Die scharfe äussere Begrenzung, sagt S c h w a n n , spricht
gegen eine Zusammensetzung dieser Membran aus Zellgewebe.