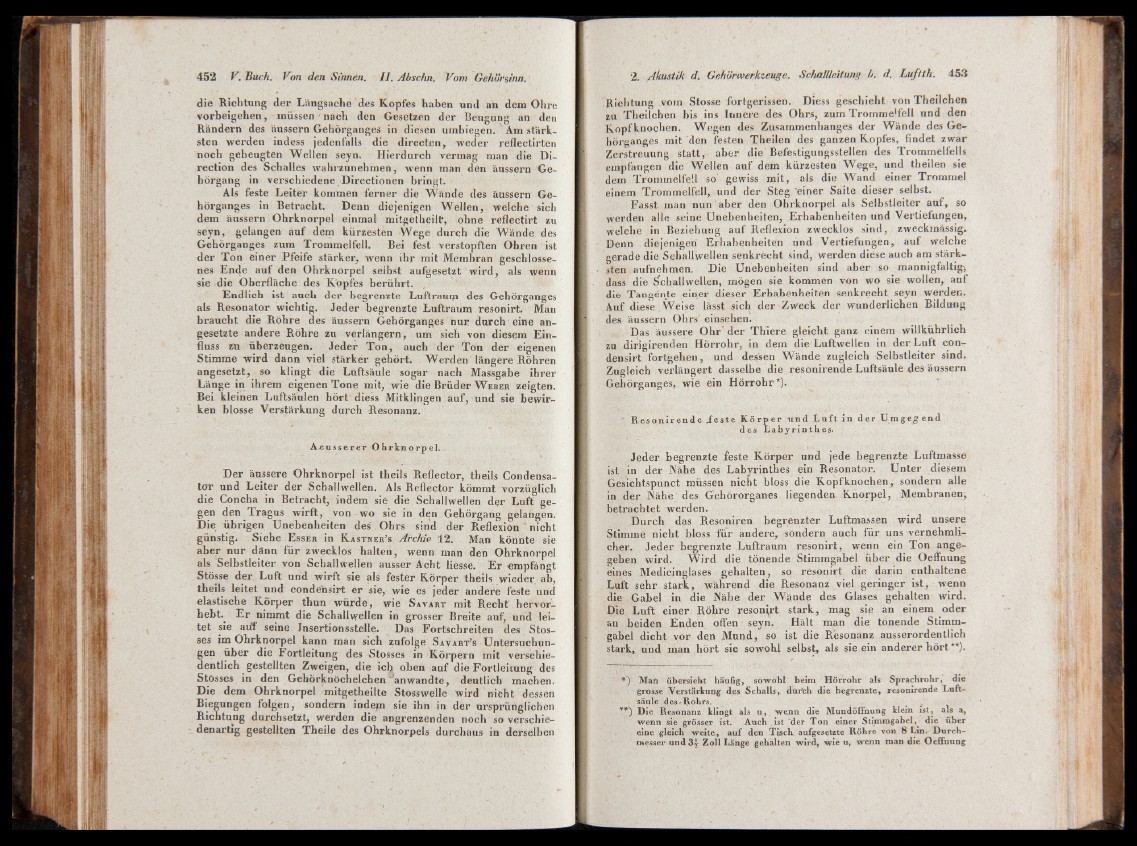
die Richtung der Längsache des Kopfes haben und an dem Ohre
Vorbeigehen, müssen nach den Gesetzen der Beugung an den
Rändern des äussern Gehörganges in diesen urnbiegen. v Am stärksten
werden indess jedenfalls die directen, weder reflectirten
noch gebeugten Wellen seyn. Hierdurch vermag man die Di-
rection des Schalles wahrzunehmen, wenn man den äussern Gehörgang
in verschiedene Directionen bringt.
Als feste Leiter kommen ferner die Wände des äussern Gehörganges
in Betracht. Denn diejenigen Wellen, welche sich
dem äussern Ohrknorpel einmal mitgetheilt, ohne reflectirt zu
seyn, gelangen auf dem kürzesten -Wege durch die Wände, des
Gehörganges zum Trommelfell. Bei fest verstopften Ohren ist
der Ton einer Pfeife stärker, wenn ihr mit Membran geschlossenes
Ende auf den Ohrknorpel seihst aufgesetzt wird, als wenn
sie die Oberfläche des Kopfes berührt.
Endlich ist auch der begrenzte Luftraum des Gehörganges
als Resonator wichtig. Jeder begrenzte Luftraum resonirt. Man
braucht die Röhre des äussern Gehörganges nur durch eine angesetzte
andere Röhre zu verlängern, um sich von diesem Einfluss
zu überzeugen. Jeder Ton, auch der Ton der eigenen
Stimme wird dann viel stärker gehört. Werden längere Röhren
angesètzt, so klingt die Luftsäule sogar nach Massgabe ihrer
Länge in ihrem eigenen Tone mit, wie die Brüder W eber zeigten.
Bei kleinen Luftsäulen hört' diess Mitkljngen auf, und sie bewirken
blosse Verstärkung durch ^Resonanz.
A - e u s s e r e r O h r k n o r p e l . ,
Der äussere Ohrknorpel ist theils Reflector, theils Condensator
und Leiter der Schallwellen. Als Reflector kömmt vorzüglich
die Concha in Betracht, indem sie die Schallwellen der Luft gegen
den Tragus wirft, von wo sie in den Gehörgang gelangen.
Die übrigen Unebenheiten des Ohrs sind der Reflexion ' nicht
günstig. Siehe E sser in K astker’s Archiv 12. Man könnte sie
aber nur dänn für zwecklos halten, wenn man den Ohrknorpel
als Selbstleiter von Schallwellen ausser Acht Hesse. Er empfangt
Stösse der Luft und wirft sie als fester Körper theils wieder ab,
theils leitet und condensirt er sie, wie es jeder andere feste und
elastische Körper thun würde, wie S avart mit Recht hervorhebt.
Er nimmt die Schallwellen in grosser Breite auf, und leitet
sie aiif seine Insertionsstelle. Das Fortschreiten des Stos-
ses im Ohrknorpel kann man sich zufolge Savart’s Untersuchungen
über die Fortleitung des Stosses in Körpern mit verschiedentlich
gestellten Zweigen, die iclj oben auf die Fortleicung des
Stösses in den Gehörknöchelchen'^anwandte, deutlich machen.
Die dem Ohrknorpel mitgetheilte Stosswelle wird nicht dessen
Biegungen folgen, sondern indepn sie ihn in der ursprünglichen
Richtung durchsetzt, werden die angrenzenden noch so verschiedenartig
gestellten Theile des Ohrknorpels durchaus in derselben
Richtung vom Stosse fortgerissen. Diess geschieht von Theilchen
zu Theilchen bis ins Innere des Ohrs, zum Tromme'fell und den
Kopfknochen. Wegen des Zusammenhanges der Wände des Gehörganges
mit den festen Tbeilen des ganzen Kopfes, findet zwar
Zerstreuung statt, aber die Befestigungsstellen des Trommelfells
empfangen die Wellen auf dem kürzesten Wege, und theilen sie
dem Trommelfell so gewiss mit, als die Wand einer Trommel
einem Trommelfell, und der Steg 'einer Saite dieser selbst.
Fasst mau nun aber den Ohrknorpel als Selbstleiter auf, so
werden alle seine Unebenheiten, Erhabenheiten und Vertiefungen,
welche in Beziehung auf Reflexion zwecklos sind, zweckmässig.
Denn diejenigen Erhabenheiten und Vertiefungen, auf welche
gerade die Schallwellen senkrecht sind, werden diese auch am stärksten
aufnehmen. Die Unebenheiten sind aber so mannigfaltig-,
dass die Schallwellen, mögen sie kommen von wo sie wollen, auf
die Tangénte einer dieser Erhabenheiten senkrecht seyn werden.
Auf diese Weise lässt sich der Zweck der wunderlichen Bildung
des-äussern Ohrs' einsehen.
Das äussere Ohr der Thiere gleicht ganz einem willkührlich
zu dirigirenden Hörrohr, in dem die Luftwellen in der Luft condensirt
fortgehen, und dessen Wände zugleich Selbstleiter sind.
Zugleich verlängert dasselbe die resonirende Luftsäule des äussern
Gehörganges, wie ein Hörrohr*).
' R e s o n i r e n d e i e s t e K ö r p e r u n d L u f t i n d e r U m g e h e n d
d e s L a b y r i n t h e s .
Jeder begrenzte feste Körper und jede begrenzte Luftmasse
ist in der Nähe des Labyrinthes ein Resonator. Unter diesem
Gesichtspunct müssen nicht bloss die Kopfknochen, sondern alle
in der Nähe des Gehörorganes liegenden. Knorpel, Membranen,
betrachtet werden.
Durch das Resoniren begrenzter Luftmassen wird unsere
Stimme nicht bloss für andere, sondern auch für uns vernehmlicher.
Jeder begrenzte Luftraum resonirt, wenn ein Ton angegeben
wird. Wird die tönende Stimmgabel über die Oeffnung
eines Medicinglases gehalten, so resonirt die darin enthaltene
Luft sehr stark, während die Resonanz viel geringer ist, wenn
die Gabel in die Nähe der Wände des Glases gehalten wird.
Die Luft einer. Röhre resonjrt stark, mag sie an einem oder
an beiden Enden offen seyn. Hält man die tönende Stimmgabel
dicht vor den Mund, so ist die Resonanz ausserordentlich
stark, und man hört sie sowohl selbst, als sie ein anderer hört**).
*) Mah übersieht häufig, sowohl beim H örrohr als Sprachrohr, die
grosse Verstärkung des Schalls, dueth die begrenzte, resonirende Luftsäule
des.Rohrs.
Die Resonanz klingt als u , wenn die Mundöffnung klein ist, als a,
wenn sie grösser ist. A u ch ,ist 'der Ton einer Stimmgabel,^ die über
eine gleich weite, auf den Tisch, aufgesetzte Röhre von 8 Lin. Du rch messer
und 3J) Zoll Länge gehalten wird, wie u, wenn man die Oeffnung