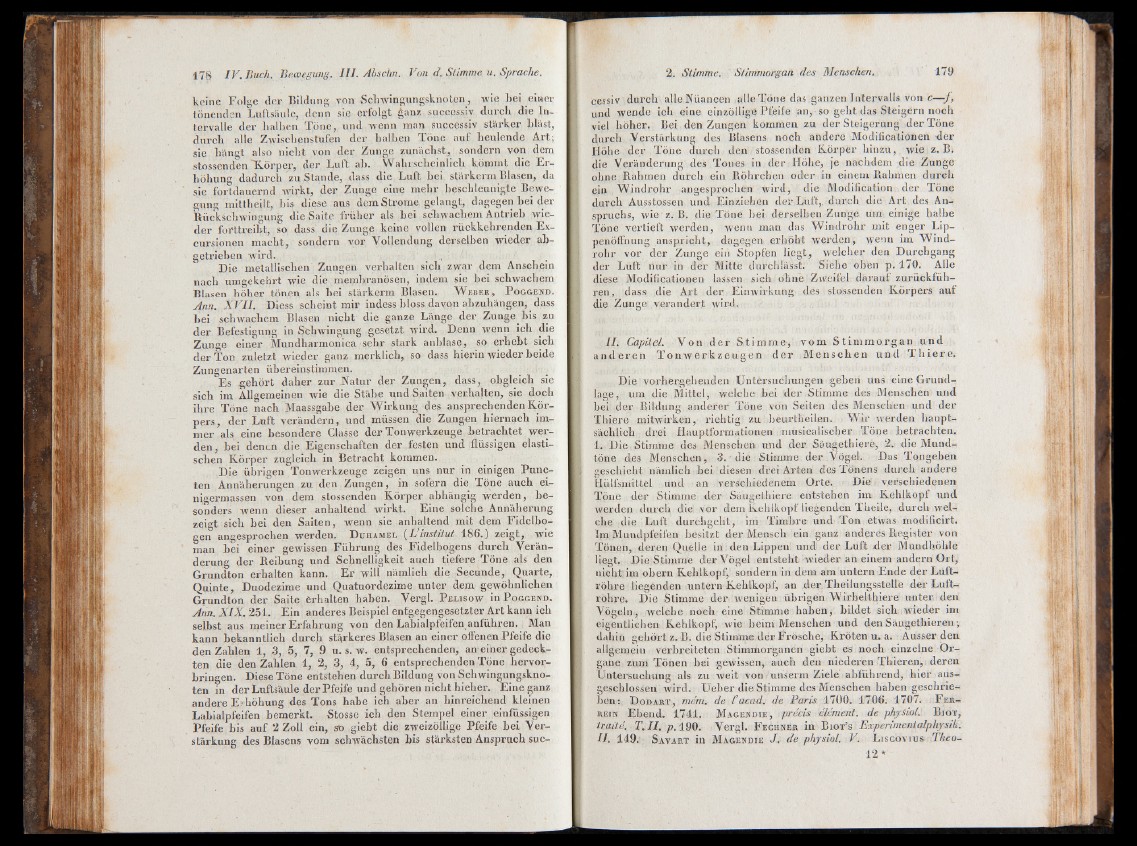
keine Folge der Bildung von Schwingungsknoten, wie bei einer
tönenden Luftsäule, denn sie erfolgt ganz successiv durch die Intervalle
der halben Töne, und wenn man successiv stärker bläst,
durch alle Zwischenstufen der halben Töne auf heulende Art;
sie hängt also nicht von der Zunge zunächst, sondern von dem
stossenden ~Körper, der Luft ab. Wahrscheinlich kömmt die Erhöhung
dadurch zuStande, dass die Luft bei stärkerm Blasen, da
sie fortdauernd wirkt, der Zunge eine mehr beschleunigte Bewegung
mittheilt, bis diese aus dem Strome gelangt, dagegen bei der
Rückschwingung die Saite früher als bei schwachem Antrieb wieder
forttreibt, so dass die Zunge keine vollen rückkehrenden Ex-
cursionen macht, sondern vor Vollendung derselben wieder abgetrieben
wird. ,
Die metallischen Zungen verhalten sich zwar dem Anschein
nach umgekehrt wie die membranösen, indem sie bei schwachem
Blasen höher tönen als bei stärkerm Blasen. W eber., P oggend.
Ann. XVII. Diess scheint mir indess bloss davon abzuhängen, dass
bei schwachem Blasen nicht die ganze Länge der Zunge bis zu
der Befestigung in Schwingung gesetzt wird. Denn wenn ich die
Zunge einer Mundharmonica sehr stark anblase, so erhebt sich
der Ton zuletzt wieder ganz merklich, so dass hierin wieder beide
Zungenarten übereinstimmen.
Es gehört daher zur Natur der Zungen, dass, obgleich sie
sich im Allgemeinen wie die Stäbe und Saiten verhalten, sie doch
ihre Töne nach Maassgabe der Wirkung des ansprechenden Körpers,
der Luft verändern, und müssen die Zungen hiernach immer
als eine besondere Classe der Tonwerkzeuge betrachtet werden
, bei denen die Eigenschaften der festen und flüssigen elastischen
Körper zugleich in Betracht kommen.
Die übrigen Tonwerkzeuge zeigen uns nur in einigen Punc-
ten Annäherungen zu den Zungen, in sofern die Töne auch ei-
nigermassen von dem stossenden Körper abhängig werden, besonders
wenn dieser anhaltend wirkt. Eine solche Annäherung
zeigt sich bei den Saiten, wenn sie anhaltend mit dem Fidelbogen
angesprochen werden. D uhamel (LiInstitut 186.;) zeigt, wie
man bei einer gewissen Führung des Fidelbogens durch Veränderung
der Reihung und Schnelligkeit auch tiefere Töne als den
Grundton erhalten kann. Er will nämlich die Secunde, Quarte,
Quinte, Duodezime und Quatuordezime unter dem gewöhnlichen
Grundton der Saite erhalten haben. Vergl. P elisow in P oggend.
Ann. XIX. 251. Ein anderes Beispiel entgegengesetzter Art kann ich
selbst aus meiner Erfahrung von den Labialpfeifen anführen. Man
kann bekanntlich durch stärkeres Blasen an einer offenen Pfeife die
den Zahlen 1, 3, 5, 7, 9 u. s. w. entsprechenden, an einer gedeckten
die den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 entsprechenden Töne hervorbringen.
Diese Töne entstehen durch Bildung von Schwingungsknoten
in der Luftsäule der Pfeife und gehören nicht hieher. Eine ganz
andere Erhöhung des Tons habe ich aber an hinreichend kleinen
Labialpfeifen bemerkt. Stosse ich den Stempel einer einfüssigen
Pfeife bis auf 2 Zoll ein, so giebt die zweizöllige Pfeife bei Verstärkung
des Blasens vom schwächsten bis stärksten Anspruch successiv
durch alleNüancen alle Töne das ganzen Intervalls von c—ƒ,
und wende ich eine einzöllige Pfeife an, so geht das Steigern noch
viel höher. Bei den Zungen kommen zu der Steigerung der Töne
durch Verstärkung des Blasens noch andere Modificationen der
Höhe der Töne durch den stossenden Körper hinzu, wie z, B.
die Veränderung des Tones in der Höhe, je nachdem die Zunge
ohne Rahmen durch ein Röhrchen oder in einem Rahmen durch
ein Windrohr angesprochen wird, ; die Modification der Töne
durch Ausstossen und Einziehen der Luft,, durch die Art des Anspruchs,
wie z. B. die Töne bei derselben Zunge um einige halbe
Töne vertieft werden, wenn man das Windrohr mit enger Lip- ,
penöffnung anspricht, dagegen erhöht werden, wenn irn Windrohr
vor der Zunge ein Stopfen liegt, welcher den Durchgang
der Luft nur in der Mitte durchlässt. Siehe oben p. 170. Alle
diese Modificationen lassen sich ohne : Zweifel darauf zurückführen,
dass die Art der Einwirkung des i stossenden Körpers auf
die Zunge;,verändert wird.
II. Capital. Von d e r S.timmey vom St immorgan und
anderen Tonwerkzeugen der Menschen und Thiere.
Die vorhergehenden Untersuchungen geben uns eine Grundlage,
um die Mittel, welche bei der Stimme des Menschen und
bei der Bildung anderer Töne von Seiten des Menschen und der
Thiere mitwirken, richtig zu beurtheilen. Wir werden hauptsächlich
drei flauptformationen musicalischer; Töne betrachten.
I. Die Stimme des Menschen und der. Säugethiere, 2. die Mundtöne
des Menschen, 3. die Stimme der Vögel. Das Tongeben
geschieht nämlich bei diesen drei Arten des Tönens durch andere
Hülfsmittel und an verschiedenem Orte. Die verschiedenen
Töne der Stimme der Säugethiere entstehen im Kehlkopf und
werden durch die vor dem Kehlkopf liegenden Theile, .durch welche
die Luft durchgeht, im Timbre und Ton etwas modificirt.
Im Mundpfeifen besitzt der Mensch ein ganz anderes Register von
Tönen, deren Quelle in den Lippen und der Luft der Mundhöhle
liegt, Die Stimme der Vögel (entsteht wieder an einem andern Ort,
nicht im obern Kehlkopf, sondern in dem am untern Ende der Luftröhre
liegenden untern Kehlkopf, an der Theilungsstelle der Luftröhre.
Die Stimme der-wenigen übrigen VVirhelthiere unter den
Vögeln, welche .noch-eine Stimme haben, bildet sich wieder im
eigentlichen Kehlkopf, wie beim Menschen und den Säugethieren ;
dahin gehört z. B. die Stimme der Frösche, Kröten u. a. Ausser den
allgemein verbreiteten Stimmorganen giebt es noch einzelne Organe
zum Tönen bei gewissen, auch den niederen Thieren, deren
Untersuchung als zu weit von unserm Ziele, abführend, hier ausgeschlossen
wird. Lieber die Stimme des Menschen haben geschrieben:
D odart., ; mém.- de l’acad. de Paris 1700. 1706. 1707. F er-
rein Ebend. 1741, Magendie, précis élément, de phySwl. B iot,
traité. T. II. p. 190. ■ Vergl. F echner in B iot’s Experimentalphysik.
II. 149; Savart in M agendie J. de physiol. V. Liscovius Theo