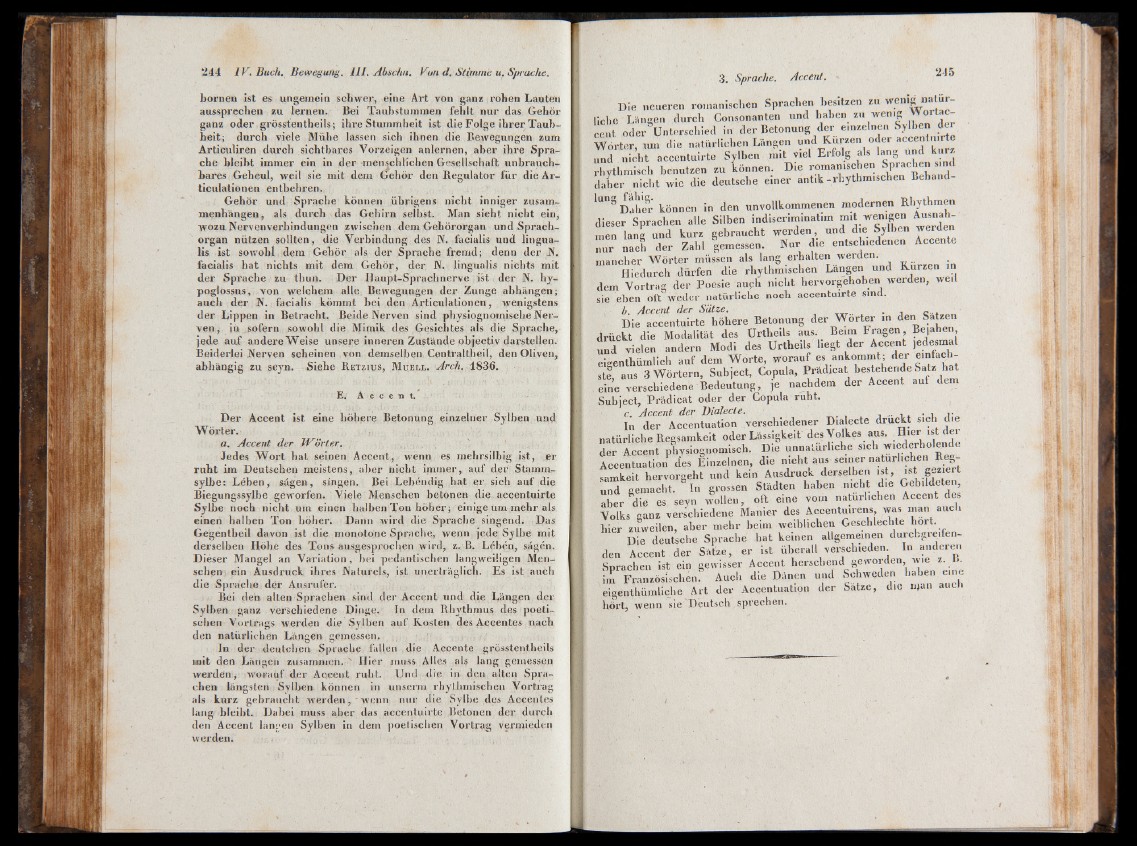
hörnen ist es ungemein schwer, eine Art von ganz rohen Lauten
aussprechen zu lernen. Bei Taubstummen fehlt nur das Gehör
ganz oder grösstentbeils; ihre Stummheit ist die Folge ihrer. Taubheit;
durch viele Mühe lassen sich ihnen die Bewegungen zum
Articuliren durch sichtbares Vorzeigen anlernen, aber ihre Sprache
bleibt immer ein in der •menschlichen Gesellschaft unbrauchbares
Geheul, weil sie mit dem Gehör den Regulator für die Ar-
ticulationen entbehren.
Gehör und Sprache können übrigens nicht inniger Zusammenhängen,
als durch das Gehirn seihst. Man sieht nicht einj
wozu Nervenverbindungen zwischen dem Gehörorgan und Sprach-
organ nützen sollten, die Verbindung des N.-facialis und lingua-
lis ist sowohl dem Gehör als der Sprache fremd; denn der ,N.
facialis hat nichts mit dem Gehör, der N. lingualis nichts mit
der Sprache zu thun. Der Haupt-Sprachnerve ist der N. hy-
poglossus, von welchem alle Bewegungen der Zunge abhängen;
auch der Pf. facialis kömmt bei den Articulationen, wenigstens
der Lippen in Betracht. Beide Nerven sind physiognomische Nerven,
in sofern sowohl die Mimik des Gesichtes als die Sprache,-
jede auf andere Weise unsere inneren Zustände objectiv darstellen.
Beiderlei Nerven scheinen von demselben Centraltheil, den Oliven,
abhängig zu seyn. Siehe R etzivs, M uele. Arch. 4836.
E. A c c e n t .
Der Accent ist eine höhere Betonung einzelner Sylben und
Wörter.
a. Accent der Wörter.
Jedes Wort hat seinen Accent, wenn es mehrsilbig ist, er
ruht im Deutschen meistens, aber nicht immer, auf der Stamm-
sylbe: Leben, sägen, singen. Bei Lebendig hat er sich auf die
Biegungssylbe geworfen. Viele Menschen betonen die, aecentuirte
Sylbe noch nicht um einen halben Ton höher; einige um.mehr als
einen halben Ton höher. Dann wird die Sprache singende I)as
Gegentbeil davon ist die monotone Sprache, wenn, jede Sylbe mit
derselben Höhe des Tons ausgesprochen wird, z,B. Löben, sägen.
Dieser Mangel an Variation, bei pedantischen langweiligen Menschen!
ein Ausdruck ihres Natureis, ist unerträglich. Es ist auch
die Sprache der Ausrufer.
Bei den alten Sprachen sind der Accent und dje Längen der
Sylben ganz verschiedene Dinge, In dem Rhythmus des poetischen
Vortrags werden die Sylben auf Rosten des Accentes nach
den natürlichen Längen gemessen.
In der deutelten Sprache fällen die Accente grösstentbeils
mit den Längen zusammen. ' Hier muss Alles als lang gemessen
werden, worauf der Accent ruht. Und die in den alten Sprachen
längsten Sylben. können in unserm rhythmischen Vortrag
als kurz gebraucht werden, ' wenn nur die Sylbe des Accentes
lang bleibt. Dabei muss aber das aecentuirte Betonen der durch
den Accent langeu Sylben in dem poetischen Vortrag vermieden
werden.
Die neueren romanischen Sprachen besitzen zu wenignatür
liehe Längen durch Consonanten und haben zu wen.g Wortaccent
oder Unterschied in der Betonung der einzelnen Sylben der
Wörter, um die natürlichen Längen und Kurzen oder aecentuirte
und nicht aecentuirte Sylben mit viel Erfolg als lang und kurz
rhythmisch benutzen zu können. Die romanischen Sprachen sind
daher nicht wie die deutsche einer antik-rhythmischen BehandlUn°
Daher können in den unvollkommenen modernen Rhythmen
dieser Sprachen alle Silben indiscriminatim mit wenigen Ausnahmen
lang und kurz gebraucht werden, und die Sylben werden
nur nach der Zahl gemessen. Nur die entschiedenen Accente
mancher Wörter müssen als lang erhalten werden.
Hiedurch dürfen die rhythmischen Längen und Kurzen m
dem Vortrag der Poesie auph nicht hervorgehoben werden, weil
sie eben oft weder natürliche noch aecentuirte smd.
b. Accent der Sätze. .
Die aecentuirte höhere Betonung der Wörter in den Sätzen
drückt die Modalität des Urtheds aus. Beim Fragen, Bejahen,
und vielen andern Modi des Urtheds liegt der Accewt jedesmal
ei^enthümlich auf dem Worte, worauf es ankommt; der einfachste,
aus 3 Wörtern, Subject, Copula, Prädicat bestehende Satz hat
eine verschiedene Bedeutung, je nachdem der Accent auf dem
Subject, Prädicat oder der Copula ruht.
c. Accent der Dialecte. . ,.
In der Accentuation verschiedener Dialecte druckt sich die
natürliche Regsamkeit oder Lässigkeit des Volkes aus. Hier ist der
der Accent physiognomisch. Die unnatürliche sich wiedcrboUndc
Accentuation des Einzelnen, die nicht aus seiner natürlichen Res
tmkeft hervorgeht und kein Ausdruck derselben ist, is geziert
und gemacht. In grossen Städten haben nicht die Gebildeten
aber die es seyn wollen, oft eine vom natürlichen Accent des
Volks ganz verschiedene Manier des Accentuirens was man auch
hier zuweilen, aber mehr beim weiblichen Geschleckte hört.
Die deutsche Sprache hat keinen allgemeinen durchgreifen
den Accent der Sätze, er ist überall verschieden In anderen
Sprachen ist ein gewisser Accent hersebend geworden wie z L
im Französischen. Auch die Dänen und Schweden haben eine
eigenthümliche Art der Accentuation der Satze, die njan auch
hört, wenn sie Deutsch, sprechen.