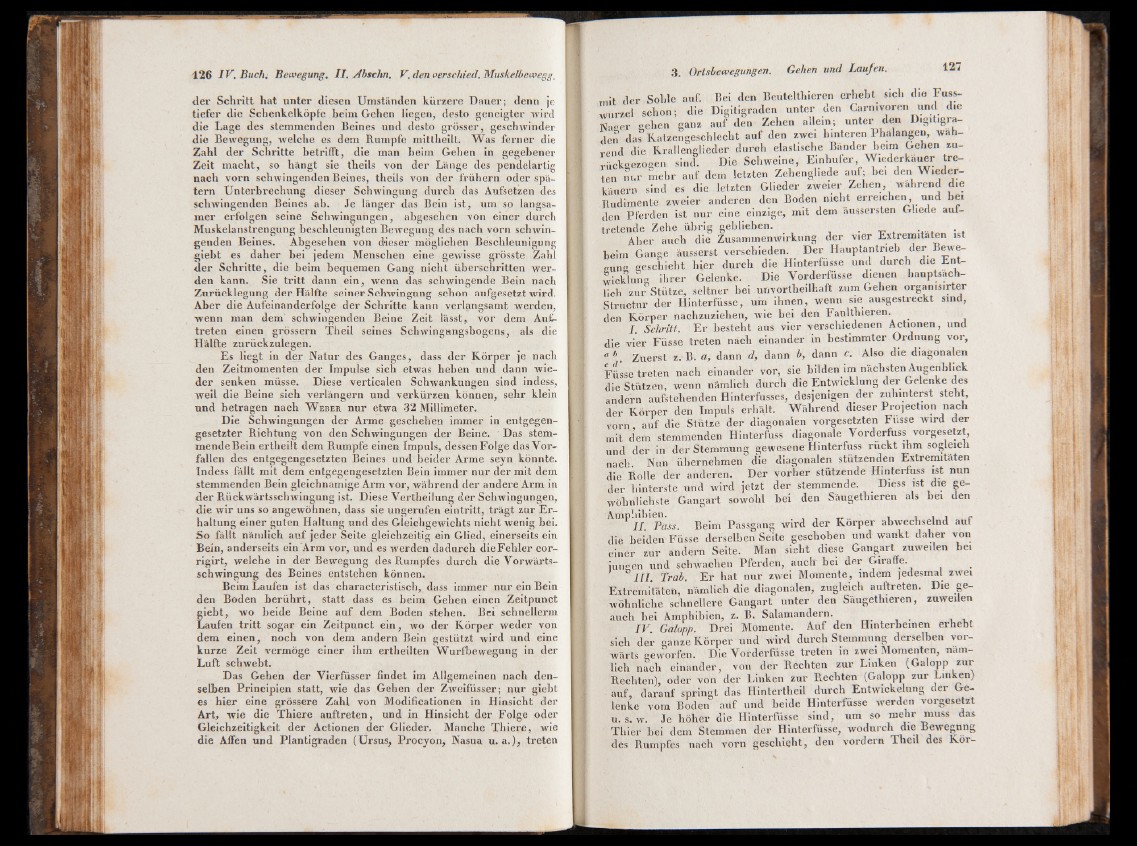
■der Schritt hat unter diesen Umständen kürzere Dauer; denn je
tiefer die Schenkelköpfe beim Gehen liegen, desto geneigter wird
die Lage des stemmenden Beines und desto grösser, geschwinder
die Bewegung, welche es dem Rumpfe mittheilt. Was ferner die
Zahl der Schritte betrifft, die man heim Gehen in gegebener
Zeit macht, so hängt sie theils von der Länge des pendelartig
nach vorn schwingenden Beines, theils von der frühem oder spätem
Unterbrechung dieser Schwingung durch das Aufsetzen des
schwingenden Beines ab. Je länger das Bein ist, um sp langsamer
erfolgen seine Schwingungen, abgesehen von einer durch
Muskelanstrengung beschleunigten Bewegung des nach vorn schwingenden
Beines. Abgesehen von dieser möglichen Beschleunigung
giebt es daher hei jedem Menschen eine gewisse grösste Zahl
der Schritte, die beim bequemen Gang nicht überschritten werden
kann. Sie tritt dann ein, wenn das schwingende Bein nach
Zurücklegung der Hälfte seiner Schwingung schon aufgesetzt wird.
Aber die Aufeinanderfolge der Schritte kann verlangsamt werden,
wenn man dem" schwingenden Beine Zeit lässt, vor dem Auftreten
einen grossem Theil seines Schwingungsbogcns, als die
Hälfte zurückzulegen.
Es liegt in der Natur des Ganges, dass der Körper je nach
den Zeitmomenten der Impulse sich etwas heben und dann wieder
senken müsse. Diese verticalen Schwankungen sind indess,
weil die Beine sich verlängern und verkürzen können, sehr klein
und betragen nach W eber nur etwa 32 Millimeter.
Die Schwingungen der Arme geschehen immer in entgegengesetzter
Richtung von den Schwingungen der Beine. Das.stem-
mendeBein ertheilt dem Rumpfe einen Impuls, dessen Folge das Vorfällen
des entgegengesetzten Beines und beider Arme seyn könnte.
Indess fällt mit dem entgegengesetzten Bein immer nur der mit dem
stemmenden Bein gleichnamige Arm vor, während der andere Arm in
der Rückwärtsschwingung ist. Diese Vertheilung der Schwingungen,
die wir uns so angewöhnen, dass sie ungerufen eintritt, trägt zur Erhaltung
einer guten Haltung und des Gleichgewichts nicht wenig bei.
So fällt nämlich auf jeder Seite gleichzeitig ein Glied, einerseits ein
Bein, anderseits ein Arm vor, und es werden dadurch die Fehler cor-
rigirt, welche in der Bewegung des Rumpfes durch die Vorwärtsschwingung
des Beines entstehen können.
Beim Laufen ist das characteristisch, dass immer nur ein Béin
den Boden berührt, statt dass es beim Gehen einen Zeitpunct
giebt, wo beide Beine auf dem Boden stehen. Bei schneller«!
Laufen tritt sogar ein Zeitpunct ein, wo der Körper weder von
dem einen, noch von dem andern Bein gestützt wird und eine
kurze Zeit vermöge einer ihm ertheilten Wurfhewegung in der
Luft schwebt.
Das Gehen der Vierfüsser findet im Allgemeinen nach denselben
Principien statt, wie das Gehen der Zweifüsser; nur giebt
es hier eine grössere Zahl von Modificationen in Hinsicht der
Art, wie die Thiere auftreten, und in Hinsicht der Folge oder
Gleichzeitigkeit der Actionen der Glieder. Manche Thiere, wie
die Affen und Plantigraden (Ursus, Procyon, Nasua u. a.), treten
mit der Sohle auf. Bei den Beutelthieren erhebt sich die Fuss-
wurzel schon; die Digitigraden unter den Carmvoren und die
N-wer sehen ganz auf den Zehen allein; unter den Dtgitigra-
<len das Katzengeschlecht auf den zwei hinteren Phalangen, während
die Krallenglieder durch elastische Bänder beim Gehen zurückgezogen
sind. Die Schweine, Einhufer, Wiederkäuer treten
„ur mehr auf dem letzten Zehengliede auf; hei den Wiederkäuern
sind es die letzten Glieder zweier Zehen, wahrend die
Rudimente zweier anderen den Boden nicht erreichen, und bei
den Pferden ist nur eine einzige, mit dem äussersten G.iede auftretende
Zehe übrig geblieben. . ..... ...
Aber auch die Zusammenwirkung der vier Extremitäten ist
heim Gange äusserst verschieden. Der Hauptantrieb der Bewei
n e geschieht hier durch die Hinterfüsse und durch die Entwicklung
ihrer Gelenke. Die Vorderfüsse dienen hauptsächlich
zur Stütze, seltner bei unvortheilhaft zum Gehen orgamsirter
Structur der Hinterfüsse, um ihnen, wenn sie ausgestreckt sind,
den Körper nachzuziehen, wie hei den Faulthieren.
I. Schritt, Er besteht aus vier verschiedenen Actionen, und
die vier Füsse treten nach einander in bestimmter Ordnung vor,
a b . Zuerst z.B. a, dann d, dann b, dann c. Also die diagonalen
Füsse treten nach einander vor, sie bilden im nächsten Augenblick
die Stützen, wenn nämlich durch die Entwicklung der Gelenke des
andern aufstehenden Hinterfusses, desjenigen der zuhinterst steht,
der Körper den Impuls erhält. Während dieser Projection nach
vorn auf die Stütze der diagonalen Vorgesetzten Füsse wird der
mit dem stemmenden Hinterfuss diagonale Vorderfuss vorgesetzt,
und der in der Stemmung gewesene Hinterfuss ruckt ihm sogleich
nach. Nun übernehmen die diagonalen stützenden Extremitäten
die Rolle der anderen. Der vorher stützende Hinterfuss ist nun
der hinterste und wird jetzt der stemmende. Diess ist die gewöhnlichste
Gangart sowohl bei den Säugethieren als hei den
Amp.H/*ien.^ p assgung wird der Körper abwechselnd auf
die beiden Füsse derselben Seite geschoben und wankt daher von
einer zur andern Seite. Man sieht diese Gangart zuweilen bei
jungen und schwachen Pferden, auch' bei der Giraffe.
III. Trab. Er hat nur zwei Momente, indem jedesmal zwei
Extremitäten, nämlich die diagonalen, zugleich auftreten. Die gewöhnliche
schnellere Gangart unter den Säugethieren, zuweilen
auch hei Amphibien, z. B. Salamandern.
IV. Galopp. Drei Momente. Auf den Hinterbeinen erhebt
sich der ganze Körper und wird durch Stemmung derselben vorwärts
geworfen. Die Vorderfüsse treten in zwei Momenten, nämlich
nach einander, von der Rechten zur Linken (Galopp zur
Rechten), oder von der Linken zur Rechten (Galopp zur Linken)
auf, darauf springt das Hintertheil durch Entwickelung der Gelenke
vom Boden aüf und beide Hinterfüsse werden vorgesetzt
u. s. w. Je höher die Hinterfüsse sind, um so mehr muss das
Thier bei dem Stemmen der Hinterfüsse, wodurch die Bewegung
des Rumpfes nach vorn geschieht, den vordem Theil des Kor