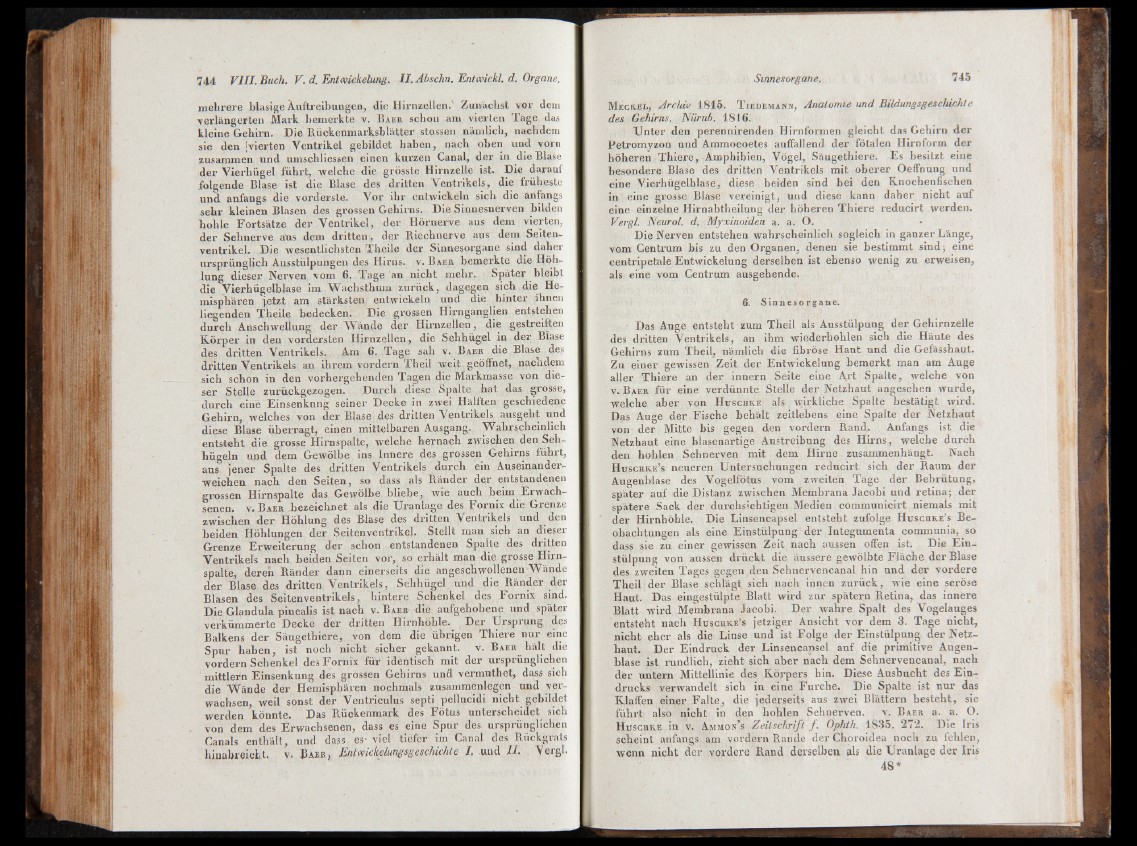
mehrere blasige Auftreibungen, die Hirnzellen.' Zunächst vor dem
verlängerten Mark bemerkte v. Baer schon am vierten Tage das
kleine Gehirn. Die Rückenmarksblätter stossen nämlich, nachdem
sie den [vierten Ventrikel gebildet haben, nach oben und vorn
zusammen und umschliessen einen kurzen Canal, der in die Blase
der Vierhügel führt, welche die grösste Hirnzelle ist. Die darauf
folgende Blase ist die Blase des dritten Ventrikels, die früheste
und anfangs die vorderste. Vor ihr entwickeln sich die anfangs
sehr kleinen Blasen des grossen Gehirns. Die Sinnesnerven bilden
hohle Fortsätze der Ventrikel, der Hörnerve aus dem vierten,
der Sehnerve aüs dem dritten, der Riechnerve aus dem Seitenventrikel.
Die wesentlichsten Theile der Sinnesorgane sind daher
ursprünglich Ausstülpungen des Hirns, v. B aer bemerkte die Höhlung
dieser Nerven vom 6. Tage an nicht mehr. Später bleibt
die Vierhügelblase im Wachsthum zurück, dagegen sich die Hemisphären
jetzt am stärksten entwickeln und die hinter ihnen
liegenden Theile bedecken. Die grossen Hirnganglien entstehen
durch Anschwellung der AVände der Hirnzellen, die gestreiften
Körper in den vordersten Hirnzellen, die Sehhügel in der Blase
des dritten Ventrikels. Am 6. Tage sah v. Baer die Blase des
dritten Ventrikels an ihrem vordem Theil weit geöffnet, nachdem
sich schon in den vorhergehenden Tagen die Markmasse von dieser
Stelle zurückgezogen. Durch diese Spalte hat das grosse,
durch eine Einsenknng seiner Decke in zwei Hälften geschiedene
Gehirn, welches von der Blase des dritten Ventrikels ausgeht nnd
diese Blase überragt, einen mittelbaren Ausgang. Wahrscheinlich
entsteht die grosse Hirnspalte, welche hernach zwischen den Sehhügeln
und dem Gewölbe ins Innere des grossen Gehirns führt,
aus jener Spalte des dritten Ventrikels durch ein Auseinanderweichen
nach' den Seiten, so dass als Ränder der entstandenen
grossen Hirnspalte das Gewölbe bliebe, wie auch beim Erwachsenen.
v. Baer bezeichnet als die Uranlage des Fornix die Grenze
zwischen der Höhlung des Blase des dritten Ventrikels und den
beiden Höhlungen der Seitenventrikel. Stellt man sich an dieser
Grenze Erweiterung der schon entstandenen Spalte des dritten
Ventrikels nach beiden Seiten vor, so erhält man die grosse Hirnspalte,
deren Ränder dann einerseits die angeschwollenen Wände
der Blase des dritten Ventrikels, Sehhügel und die Ränder der
Blasen des Seitenventrikels, hintere Schenkel des Fornix sind.
Die Glandula pinealis ist nach v. Baer die aufgehobene und spätei
verkümmerte Decke der dritten Hirnhöhle. Der Ursprung des
Balkens der Säugethiere, von dem die übrigen Thiere nur eine
Spur haben, ist noch nicht sicher gekannt, v. Baer hält die
vordem Schenkel des Fornix für identisch mit der ursprünglichen
mittlern Einsenkung des grossen Gehirns und vermuthet, dass sich
die Wände der Hemisphären nochmals Zusammenlegen und verwachsen,
weil sonst der Ventriculus septi pellucidi nicht^ gebildet
werden könnte. Das Rückenmark des Fötus unterscheidet sich
von dem des Erwachsenen, dass es eine Spur des ursprünglichen
Canals enthält, und dass es* viel tiefer im Canal des Rückgrats
hinabreicht, v. Baer, Entwickelungsgeschichte I. -und II. Vergl.
Meckel, Archiv 1815. T iedemann, Anatomie und Bildungsgeschichte
des Gehirns. Nürnb. 1816.
Unter den perennirenden Hirnformen gleicht das Gehirn der
Petromyzon und Ammocoetes auffallend der fötalen Hirnform der
höheren Thiere, Amphibien, Vögel, Säugethiere. Es besitzt eine
besondere Blase des dritten Ventrikels mit oberer Oeffnung und
eine Vierhügelblase, diese beiden sind bei den Knochenfischen
in eine grosse Blase vereinigt, und diese kann daher nicht auf
eine einzelne Hirnabtheilung der höheren Thiere reducirt werden.
Vergl. Neurol. d. Myxinoiden a. a. O.
Die Nerven entstehen wahrscheinlich sogleich in ganzer Länge,
vom Centrum bis zu den Organen, denen sie bestimmt sind; eine
centripetale Entwickelung derselben ist ebenso wenig zu erweisen,
als eine vom Centrum ausgehende.
6. S i n n e s o r g a n e .
Das Auge entsteht zum Theil als Ausstülpung der Gehirnzelle
des dritten Ventrikels, an ihm wiederhohlen sich die Häute des
Gehirns zum Theil, nämlich die fibröse Haut und die Gefässhaut.
Zu einer gewissen Zeit der Entwickelung bemerkt man am Auge
aller Thiere an der innern Seite eine A.rt Spälte, welche von
v. Baer für eine verdünnte Stelle der Netzhaut angesehen wurde,
welche aber von H uschke als wirkliche Spalte bestätigt wird.
Das Auge der Fische behält zeitlebens eine Spalte der Netzhaut
von der Mitte bis gegen den vordem Rand. Anfangs ist die
Netzhaut eine blasenartige Austreibung des Hirns, welche durch
den hohlen Sehnerven mit dem Hirne zusammenhängt. Nach
H uschke’s neueren Untersuchungen reducirt sich der Raum der
Augenblase des Vogelfötus vom zweiten Tage der Bebrütung,
später auf die Distanz zwischen Membrana Jacobi und retina; der
spätere Sack der durchsichtigen Medien communicirt niemals mit
der Hirnhöhle. Die Linsencapsel entsteht zufolge H uschke’s Beobachtungen
als eine Einstülpung der Integumenta communia, so
dass sie zu einer gewissen Zeit nach aussen offen ist. Die Einstülpung
von aussen drückt die äussere gewölbte Fläche der Blase
des zweiten Tages gegen den Sehnervencanal hin und der vordere
Theil der Blase schlägt sich nach innen zurück, wie eine seröse
Haut. Das eingestülpte Blatt wird zur spätem Retina, das innere
Blatt wird Membrana Jacobi. Der wahre Spalt des Vogelauges
entsteht nach H uschke’s jetziger Ansicht vor dem 3. Tage nicht,
nicht eher als die Linse und ist Folge der Einstülpung der Netzhaut.
Der Eindruck der Linsencapsel auf die primitive Augenblase
ist rundlich, zieht sich aber nach dem Sehnervencanal, nach
der untern Mittellinie des Körpers hin. Diese Ausbucht des Eindrucks
verwandelt sich in eine Furche. Die Spalte ist nur das
Klaffen einer Falte, die jederseits aus zwei Blättern besteht, sie
führt also nicht in den hohlen Sehnerven. v. B aer a. a. O.
H uschke in v. Ammoh’.s Zeitschrift f . Ophth. 1835. 2 /2. Die Iris
scheint anfangs am vordem Rande der Choroidea noch zu fehlen,
wenn nicht der vordere Rand derselben als die Uranlage der Iris