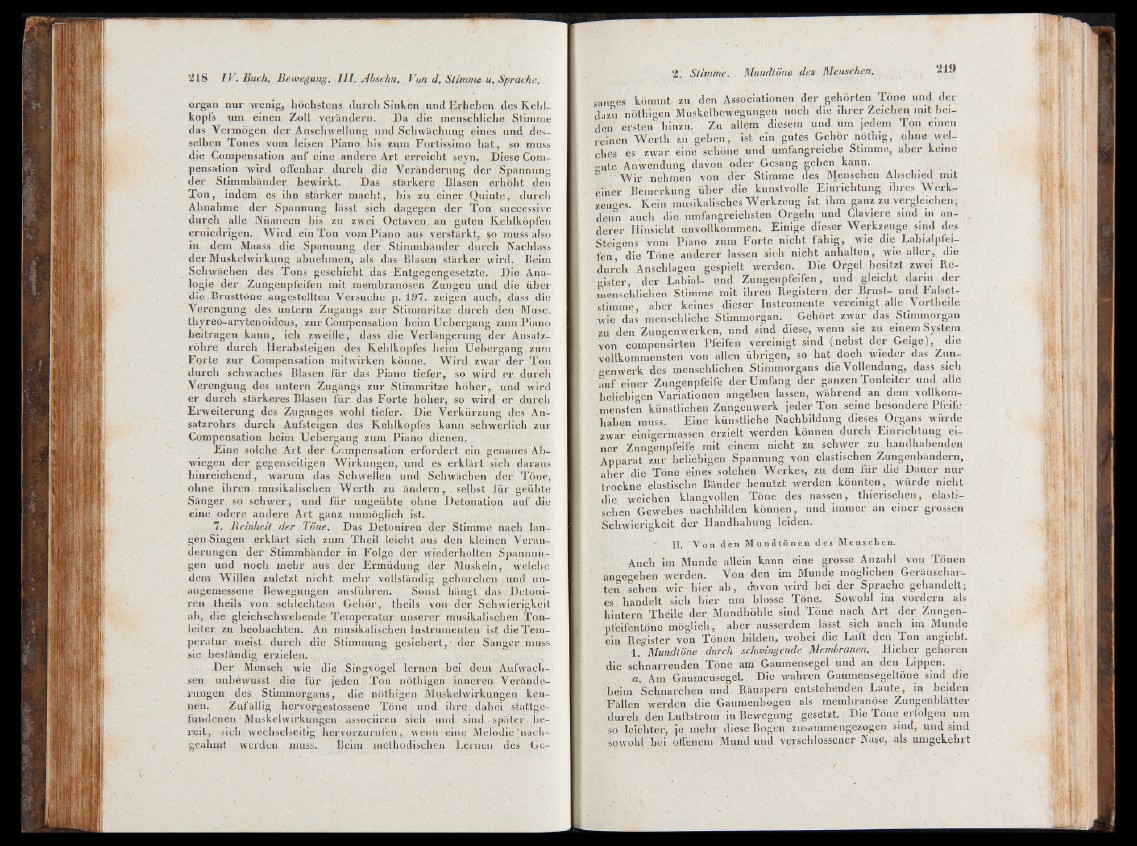
organ nur wenig, höchstens durch Sinken und Erheben des Kehltopfs
um einen Zoll verändern. Da die menschliche Stimme
das Vermögen der Anschwellung und Schwächung eines und desselben
Tones vom leisen Piano bis eum Fortissimo hat, so muss
die Compensation auf eine andere Art erreicht seyn. Diese Com-
pensation 'wird offehbar durch die Veränderung der Spannung
der Stimmbänder bewirkt. Das stärkere Blasen erhöht den
f ö n , indem es ihn stärker macht, bis zu einer Quinte, durch
Abnahme der Spannung lässt sich dagegen der Ton successive
durch alle Nuancen bis zu zwei Octaven. an guten Kehlköpfen
erniedrigen. Wird ein Ton vom Piano aus verstärkt, so muss also
in dem Maass . die Spannung der Stimmbänder durch 'Nachlass
der Muskelwirkung abuehmen, als das Blasen stärker wird. Beim
Schwächen des Tons geschieht das Entgegengesetzte. Die Ana-
lo gie der Zungenpfeifen mit membranösen Zungen und die über
die Brusttöne angestellten Versteche p. 197. zeigen auch, dass die
Verengung des untern Zugangs zur Stimmritze durch den Muse,
thyreo-arytenoideus, zur Compensation beim Uebergang zum Piano
beitragen kann, ich zweifle, dass die Verlängerung der Ansatzröhre
durch Herabsteigen des Kehlkopfes heim Uebergang zum
Forte zur Compensation mitwirken könne. Wird zwar der Ton
durch schwaches Blasen für das Piano tiefer, so wird er durch
Verengung des untern Zugangs zur Stimmritze höher, und wird
er durch stärkeres Blasen für das Forte höher, so wird er durch
Erweiterung des Zuganges wohl tiefer. Die Verkürzung des Ansatzrohrs
durch Aufsteigen des Kehlkopfes kann schwerlich zur
Compensation heim Uebergang zum Piano dienen.
Eine solche Art der Compensation erfordert ein genaues Abwiegen
der gegenseitigen Wirkungen, und es erklärt sich daraus
hinreichend, warum das Schwellen und Schwächen der Töne,
ohne ihren musikalischen Werth zu ändern, , selbst für geübte
Sänger, so schwer , und für ungeübte ohne Detonation auf die
eine ödere andere Art ganz unmöglich ist.
7. Reinheit der Töne. Das Detoniren der Stimme nach langen
Singen erklärt sich zum Theil leicht aus den kleinen Veränderungen
der Stimmbänder in Folge der wiederholten Spannungen
und noch mehr aus der Ermüdung der Muskeln, welche
dem Willen zuletzt nicht mehr vollständig gehorchen und unangemessene
Bewegungen ausführen. Sonst hängt das Detoui-
ren theils von schlechtem Gehör, theils von der Schwierigkeit
ab, die gleichschwebende Temperatur unserer musikalischen Tonleiter
zu beobachten. An musikalischen Instrumenten ist die Temperatur
meist durch die Stimmung gesichert,' der Sänger muss
sie beständig erzielen.
Der, Mensch wie die Singvögel lernen bei dem Aufwachsen
unbewusst die für jeden Ton nöthigen inneren Veränderungen
des Stimmorgans, die nöthigen Muskelwirkungen kennen.
Zufällig hervorgestossene Töne und ihre dabei stattgefundenen
Muskelwirkungen associiren sich und sind später bereit,
.sich wechselseitig hervorzurufen , wenn eine Melodie ’nach—
geahmt werden muss. Beim methodischen Lernen des Gesanges
kömmt zu den Associationen der gehörten Töne und der
d a z u nöthigen Muskelbewegungen noch die ihrer Zeichen mit beiden
ersten hinzu. Zu allem diesem und um jedem Ton einen
reinen Werth zu geben, ist ein gutes Gehör nöthig, ohne welches
es zwar eine schöne und umfangreiche Stimme, aber keine
<mte Anwendung davon oder Gesang geben kann.
° Wir nehmen von der Stimme des Menschen Abschied mit
einer Bemerkung über die kunstvolle Einrichtung ihres Werkzeuges.
Kein musikalisches Werkzeug ist ihm ganz zu vergleichen;
denn auch die umfangreichsten Orgeln und Cla'viere sind in an- ,
derer Hinsicht unvollkommen. Einige dieser Werkzeuge sind des
Stemens vom Piano zum Forte nicht fähig, wie die Labialpfeifen
° die Töne anderer lassen sich nicht anhalten, wie aller, die
durch Anschlägen gespielt werden. Die Orgel besitzt zwei Register,
der Labial- und Zungenpfeifen, und gleicht darin der
menschlichen Stimme mit ihren Registern der Brust- und Falset-
stimme, aber keines dieser Instrumente vereinigt alle Vorlheile
wie das menschliche Stimmorgan. Gehört zwar das Stimmorgan
zu den Zungenwerken, und sind diese, wenn sie zu einem System
von compensirten Pfeifen vereinigt sind (nebst der Geige), die
vollkommensten von allen übrigen, so hat doch wieder das Zun-
genwerk des menschlichen Stimmorgans die Vollendung, dass sich
auf einer Zungenpfeife der Umfang der ganzen Tonleiter und alle
beliebigen Variationen angehen lassen, während an dem vollkommensten
künstlichen Zungenwerk jeder Ton seine besondere Pfeife
haben muss. Eine künstliche Nachbildung dieses Organs würde
zwar einigermassen erzielt werden können durch Einrichtung einer
Zunmmpfeife mit einem nicht zu schwer zu handhabenden
Apparat zur beliebigen Spannung von elastischen Zungenbändern,
aber die Töne eines solchen Werkes, zu dem für die Dauer nur
trockne elastische Bänder benutzt werden könnten, würde nicht
die weichen klangvollen Töne des nassen, thierischen, elastischen
Gewebes nachbilden können, und immer an einer grossen
Schwierigkeit der Handhabung leiden.
' II. V o n d e n M u n d t ö n e n d e s M e n s c h e n .
Auch im Munde allein kann eine grosse Anzahl, von Tönen
angegeben werden. Von den im Munde möglichen Geräuschar-
teü sehen, wir hier ab, davon wird bei der Sprache gehandelt;
es handelt sich hier um blosse Töne. Sowohl im vordem als
hintern Tlieile der Mundhöhle sind Töne nach Art der Zungenpfeifentöne
möglich, aber ausserdem lässt sich auch im Munde
ein Register von Tönen bilden, wobei die Luft den Ton angieht.
1. Mundtöne durch schwingende Membranen. Hieher gehören
die schnarrenden Pöne am Gaumensegel und an den Lippen.
a. Am Gaumensegel. Die wahren Gaumensegeltöne sind die
heim Schnarchen und Räuspern entstehenden Laute, in beiden
Uällen werden die Gaumenbogen als membranöse Zungenblätter
durch den Luftstrom in Bewegung gesetzt. Die Töne erfolgen um
so leichter, je mehr diese Bogen zusammengezogen sind, und sind
sowohl bei offenem Mund unil verschlossener Nase, als umgekehrt