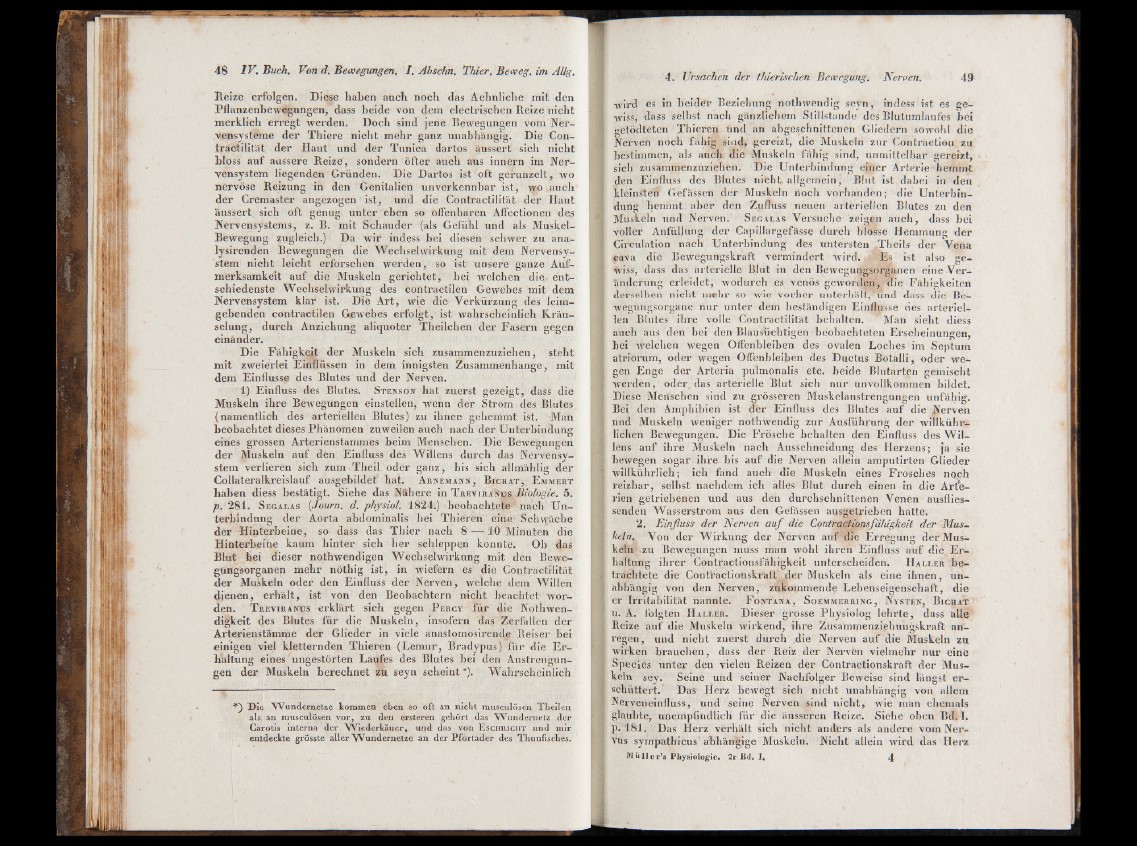
Reize erfolgen. Diese haben auch noch das Aehnliche mit den
Pflanzenbewegungen, dass beide von dem electrischen Reize nicht
merklich erregt werden. Doch sind jene Bewegungen vom Nervensysteme
der Thiere nicht mehr ganz unabhängig. Die Con-
träctilität der Haut' und der Tunicä dartos äussert sich nicht
bloss auf äussere Reize, sondern öfter auch aus innern im Nervensystem
liegenden Gründen. Die Dartos ist oft gerunzelt, avo
nervöse Reizung in den Genitalien unverkennbar ist, wo auch
der Cremaster angezogen ist, und die Contractilität der Haut
äussert sich oft genug unter eben so offenbaren Affectionen de,s
Nervensystems, z. B. mit Schauder (als Gefühl und als Muskel-
Bewegung zugleich.) Da wir indess bei diesen schwer, zu ana-
lysirenden Bewegungen die Wechselwirkung mit dem Nervensystem
nicht leicht erforschen werden, so ist unsere ganze Aufmerksamkeit
auf die Muskeln gerichtet, bei Avelchen die/ entschiedenste
Wechselwirkung des contractilen Gewebes mit dem
Nervensystem klar ist. Die Art, wie die Verkürzung des leimgebenden
contractilen Gewebes erfolgt, ist wahrscheinlich Kräuselung,
durch Anziehung aliquoter Theilchen der Fasern gegen
einander.
Die Fähigkeit der Muskeln sich zusammenzuziehen, steht
mit zweierlei Einflüssen in dem innigsten Zusammenhänge, mit
dem Einflüsse des Blutes und der Nerven.
1) Einfluss des Blutes. Stenson hat zuerst gezeigt): dass die
Muskeln ihre Bewegungen einstellen, wenn der Strom des Blutes
(namentlich des - arteriellen Blutes) zu ihnen gehemmt ist. Man
beobachtet dieses Phänomen zuweilen auch nach der Unterbindung
eines grossen Arterienstammes beim Menschen. Die BeAvegungen
der Muskeln auf den Einfluss des Willens durch das Nervensystem
verlieren sich zum Theil. oder ganz, bis sich allmählig der
Collateralkreislauf ausgebildet hat. Arnemann, Bichat^ E mmert
haben diess bestätigt. Siehe das Nähere in T reviranus Biologie. 5.
p. 281. Segalas (Journ. d. physiol. 1824.) beobachtete nach Unterbindung
der Aorta abdominalis bei Thieren eine Schv^äche
der Hinterbeine, so dass das Thier nach 8 — 10 Minuten die
Hinterbeine kaum hinter sich her schleppen konnte. Ob das
Blut bei dieser nothwendigen Wechselwirkung mit den Bewegungsorganen
mehr nöthig ist, in wiefern es die Contractilität
der Muskeln oder den Einfluss der Nerven, welche dem Willen
dienen, erhält, ist von den Beobachtern nicht beachtet- worden.
T reviranus erklärt sich gegen P ercy für die Nothwen-
digkeit des Blutes für die Muskeln, insofern das Zerfallen der
Arterienstämme der Glieder in viele anastomosirende Reiser bei
einigen viel kletternden Thieren (Lemur, Bradypus) für die Erhaltung
eines ungestörten Laufes des Blutes bei den Anstrengungen
der Muskeln berechnet zu seyn scheint *). Wahrscheinlich
D ie W un d ern etze kommen eben so oft an nicht musculöse'n Theilen
als, an musculösen vor, zu den ersteren gehört das W un d ern etz der
Carotis interna der W ied erk äu e r, und das von EsCHRICIlT und mir
entdeckte grösste aller W u n d em etz e an der Pfortader des Thunfisches.
wird es in beider Beziehung nothivendig seyn, indess ist es gewiss,
dass selbst nach gänzlichem Stillstände des Blutumlaufes bei
getödteten Thieren und an abgeschnittenen Gliedern ‘sowohl die
Nerven noch fähig sind, gereizt, die Muskeln zur Contraction zu
bestimmen, als auch die Muskeln fähig sind, unmittelbar gereizt,
sich zusammenzuziehen. Die Unterbindung einer Arterie hemmt
den Einfluss des Blutes nicht, allgemein, Blut ist dabei in den
kleinsten Gefässen der Muskeln noch vorhanden; die Unterbindung
hemmt, aber den Zufluss neuen arteriellen Blutes zu den
Muskeln und Nerven. S e g a l a s Versuche zeigen auch, dass bei
voller Anfüljung der Capillargefässe durch bloirse Hemmung der
Cir'culation nach Unterbindung des untersten .Theits der Vena
cava die Bewegungskraft vermindert .wi r d.Es ist also gewiss,
dass das arterielle Blut in den Bewegungsorganen eine Veränderung
erleidet, wodurch es venös geivorden, die Fähigkeiten
derselben nicht mehr so Avie vorher unterhält,-und dass die Be-
wegurigsorgänc nur unter dem beständigen Einflüsse des arteriellen
Blutes ihre volle Contractilität behalten. Man sieht diess
auch aus den bei den Blausüchtigen beobachteten Erscheinungen,
bei Atelclien wegen Offenbleiben des ovalen Loches im Septum
atriorum, oder wegen Offenbleiben des Ductus Bötalli, oder wegen
Enge der Arteria pülmonalis etc. beide Blutarten gemischt
werden,' oder das arterielle Blut sich nur unvollkommen bildet.
Diese Menschen sind zu grösseren Muskelanstrengungen unfähig.
Bei den Amphibien ist der Einfluss des Blutes auf die Nerven
.und Muskeln weniger nothwendig zur Ausführung der willkühr-
lichen Bewegungen. Die Frösche behalten den Einfluss des Willens
auf ihre Muskeln nach Ausschneidung des Herzens; ja sie
bewegen sogar ihre^bis auf die Nerven allein amputirten Glieder
willkührlich; ich fand auch die Muskeln eines Frosches noch
reizbar, selbst nachdem ich alles'Blut durch einen in die Arterien
getriebenen und aus den durchschnittenen Venen ausflies-
senden Wasserstrom aus den Gefässen ausgetrieben hatte.
2. Einfluss der Nerven auf die Contractionsfähigkeit der Muskeln.
Von der Wirkung der Nerven auf diè Erregung der Muskeln
zu Bewegungen muss man wohl ihren Einfluss auf die Erhaltung
ihrer Contractionsfähigkeit unterscheiden. H aller betrachtete
die ContbactionskrafC der Muskeln als eine ihnen, unabhängig
von den Nerven, zukommende Lebenseigenschaft, die
er Irritabilität nannte. F ontana, S oemmerring, Nysten, B ichat
u. A. folgten H aller. Dieser grosse Physiolog lehrte, dass alle
Reize auf die Muskeln wirkend, ihre Zusammenziehungskraft anregen,
und nicht zuerst durch die Nerven auf die Muskeln zu
wirken brauchen, dass der Reiz der Nerven vielmehr nur eine
Speciés unter den vielen Reizen der Contractionskraft der Muskeln
sey. Seine und seiner Nachfolger Beweise sind längst erschüttert.
Das Herz bewegt sich nicht unabhängig von allem
Nerveneinfluss, und seine Nerven sind nicht, wie man ehemals
glaubte, unempfindlich für die äusseren Reize. Siehe oben Bd. L
p. 181. Das Herz verhält sich nicht anders als andere vornNer-
vüs sympathicus’ abhängige Muskeln. Nicht allein wird das Herz
M ü lle r’s Physiologie. 2r Bei. I* 4