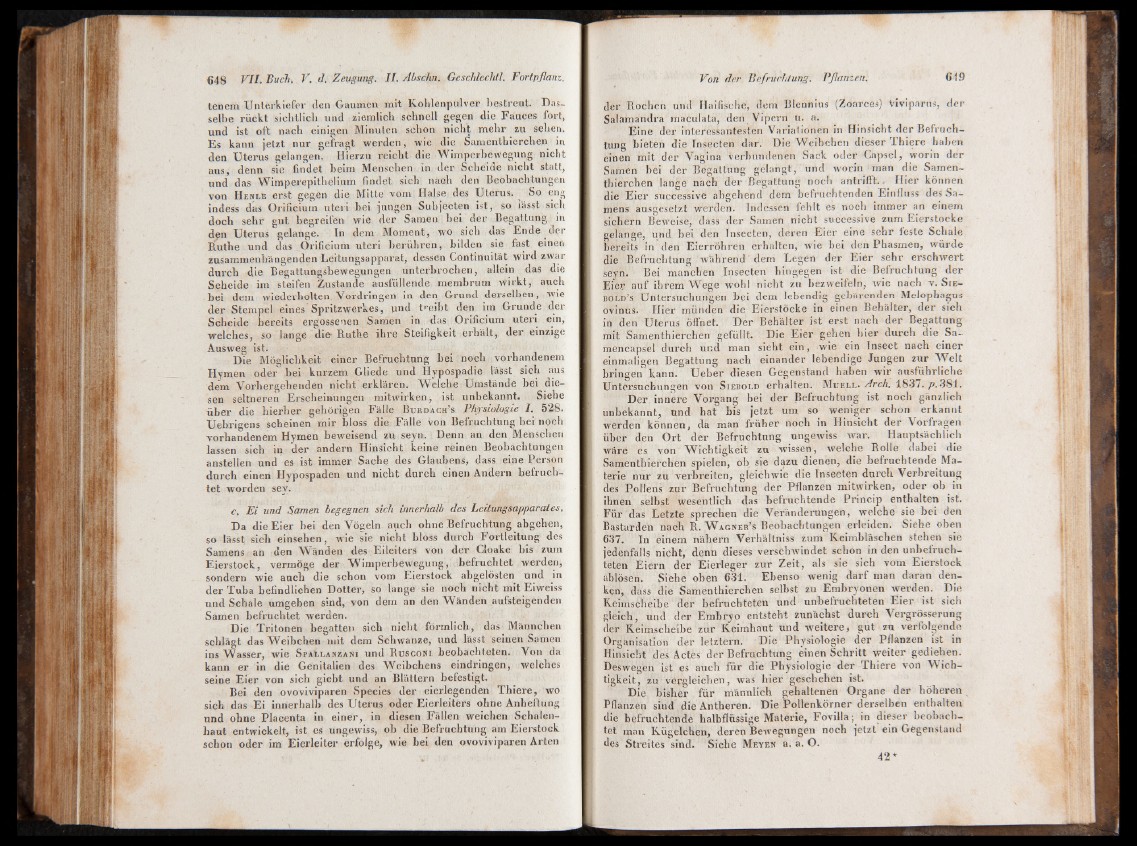
tenem Unterkiefer den Gaumen mit Kohlenpulver bestreut. Dasselbe
rückt sichtlich und ziemlich schnell gegen die Fauces fort,
und ist oft nach einigen Minuten schon nicht mehr zu sehen.
Es kann jetzt nur gefragt werden, wie die Samenthierchen in
den Uterus gelangen. Hierzu reicht die Wimperbewegung nicht
aus, denn sie findet beim Menschen in der Scheide nicht statt,
und das Wimperepithelium findet sich nach den Beobachtungen
von H e n l e erst gegen die Mitte vom Halse des Uterus.^ So eng
indess das Orificiuin uteri bei jungen Subjecten ist, so lässt sich
doch sehr gut begreifen wie der Samen bei der Begattung in
dpn Uterus gelange. In dem Moment, wo sich das Ende der
Ituthe und das Orificium uteri berühren, bilden sie fast einen
zusammenhängenden Leitungsapparat, dessen Continuität wird zwar
durch die Begattungsbewegungen unterbrochen, allein das die
Scheide im steifen Zustande ausfüllende membrum wirkt, auch
bei dem wiederholten Vordringen in den Grund derselben, wie
der Stempel eines Spritzwerkes, und treibt den, im Grunde der
Scheide bereits ergossenen Samen in das Orificium uteri ein,
welches, so lange die’ Ruthe ihre Steifigkeit erhält, der einzige
Ausweg ist.
Die Möglichkeit einer Befruchtung bei noch vorhandenem
Hymen oder bei kurzem Gliede und Hypospadie lässt sich aus
dem Vorhergehenden nicht erklären. Welche Umstände bei diesen
seltneren Erscheinungen mitwirken, ist unbekannt. Siehe
über die hierher gehörigen Fälle Bubdach’s Physiologie I. 528.
Uebrigens scheinen mir bloss die Fälle von Befruchtung bei noch
vorhandenem Hymen beweisend zu seyn. Denn an den Menschen
lassen sich in der andern Hinsicht keine reinen Beobachtungen
anstellen und es ist immer Sache des Glaubens, dass eine Person
durch einen Hypospaden und nicht durch einen Andern befruchtet
worden sev.
c. Ei und Samen begegnen sich innerhalb des Leitungsapparates.
Da die Eier bei den Vögeln auch ohne Befruchtung abgehen,
so lässt sich einsehen, wie sie nicht bloss durch Fortleitung des
Samens an den Wänden des Eileiters von der Cloake bis zum
Eierstock, vermöge der Wimperbewegung, , befruchtet werden,
sondern wie auch die schon vom Eierstock abgelösten und in
der Tuba befindlichen Dotter, so lange sie noch nicht mit Eiweiss
und Schale umgeben sind, von dem an den Wänden aufsteigenden
Samen befruchtet werden.
Die Tritonen begatten sich nicht förmlich, das Männchen
schlägt das Weibchen mit dem Schwänze, und lässt seinen Samen
ins Wasser, wie S p a l l a n z a n i und Ruscom beobachteten. Von da
kann er in die Genitalien des Weibchens eindringen, welches
seine Eier von sich giebt und an Blättern befestigt.
Bei den ovoviviparen Species der eierlegenden Thiere, wo
sich das Ei innerhalb des Uterus oder Eierleiters ohne Anheftung
und ohne Placenta in einer, in diesen Fällen weichen Schalenhaut
entwickelt, ist es ungewiss, ob die Befruchtung am Eierstock
schon oder im Eierleiter erfolge, wie bei den ovoviviparen Arten
der Rochen und Haifische, dem Blennius (Zoarces) Vivipnrus, der
Salämandra maculata, den Vipern u. a.
Eine der interessantesten Variationen in Hinsicht der Befruchtung
bieten die fnsecten dar. Die Weibchen dieser Thiere haben
einen mit der Vagina verbundenen Sack oder Capsel, worin der
Samen bei der Begattung gelangt, und worin man die Samenthierchen
lange nach der Begattung noch antrifft.. Hier können
die Eiei’ successive abgehend dem befruchtenden Einfluss des Samens
ausgesetzt werden. Indessen fehlt es noch immer an einem
sichern Beweise, dass der Samen nicht successive zum Eierstocke
gelange, und bei den Insecten, deren Eier eine sehr feste Schale
bereits in den Eierröhren erhalten, wie bei den Phasmen, würde
die Befruchtung während dem Legen der Eier sehr erschwert
seyn. Bei manchen Insecten hingegen ist die Befruchtung der
Eier auf ihrem Wbge wohl nicht zu bezweifeln, wie nach v. Sie-
b o l d ’s Untersuchungen bei dem lebendig gebärenden Melophagus
ovinus. Hier münden die Eierstöcke in einen Behälter, der sich
in den Uterus öffnet. Der Behälter ist erst nach der Begattung
mit Samenthierchen gefüllt. Die Eier gehen hier durch die Sa-
mencapsel durch und man sieht ein, wie ein Insect nach einer
einmaligen Begattung nach einander lebendige Jungen zur Welt
bringen kann. Ueber diesen Gegenstand haben wir ausführliche
Untersuchungen von S i e b o l d erhalten. M u e l l . Arch. 183/. p. 381.
Der innere Vorgang bei der Befruchtung ist noch gänzlich
unbekannt, und hat bis jetzt um so weniger schon erkannt
werden können, da man früher noch in Hinsicht der Vorfragen
über den Ort der Befruchtung ungewiss war. Hauptsächlich
wäre es von Wichtigkeit zu wissen, welche Rolle dabei die
Samenthierchen spielen, ob sie dazu dienen, die befruchtende Materie
nur zu verbreiten, gleichwie die Insecten durch Verbreitung
des Pollens zur Befruchtung der Pflanzen mitwirken, oder ob in
ihnen selbst wesentlich das befruchtende Princip enthalten ist.
Für das Letzte sprechen die Veränderungen, welche sie bei den
Bastarden nach R. W agner’s Beobachtungen erleiden. Siehe oben
637. In einem nähern Verhältniss zum Keimbläschen stehen sie
jedenfalls nicht, denn dieses verschwindet schon in den unbefruchteten
Eiern der Eierleger zur Zeit, als sie sich vom Eierstock
ablösen. Siehe oben 631. Ebenso wenig darf man daran denken,
dass die Samenthierchen selbst zu Embryonen werden. Die
Keimscheibe der befruchteten und unbefruchteten Eier ist sich
gleich, und der Embryo entsteht zunächst durch Vergrösserung
der Keimscheibe zur Keimhaut und weitere, gut zu verfolgende
Organisation der letztem. Die Physiologie der Pflanzen ist in
Hinsicht des Actes der Befruchtung einen Schritt weiter gediehen.
Deswegen ist es auch für die Physiologie der Thiere von Wichtigkeit,
zu vergleichen, was hier geschehen ist.
Die bisher für männlich gehaltenen Organe der höheren
Pflanzen sind die Antheren. Die Pollenkörner derselben enthalten
die befruchtende halbflüssige Materie, Fovilla; in dieser beobachtet
man Kügelchen, deren Bewegungen noch jetzt ein Gegenstand
des Streites sind. Siehe Meyen a. a. O.