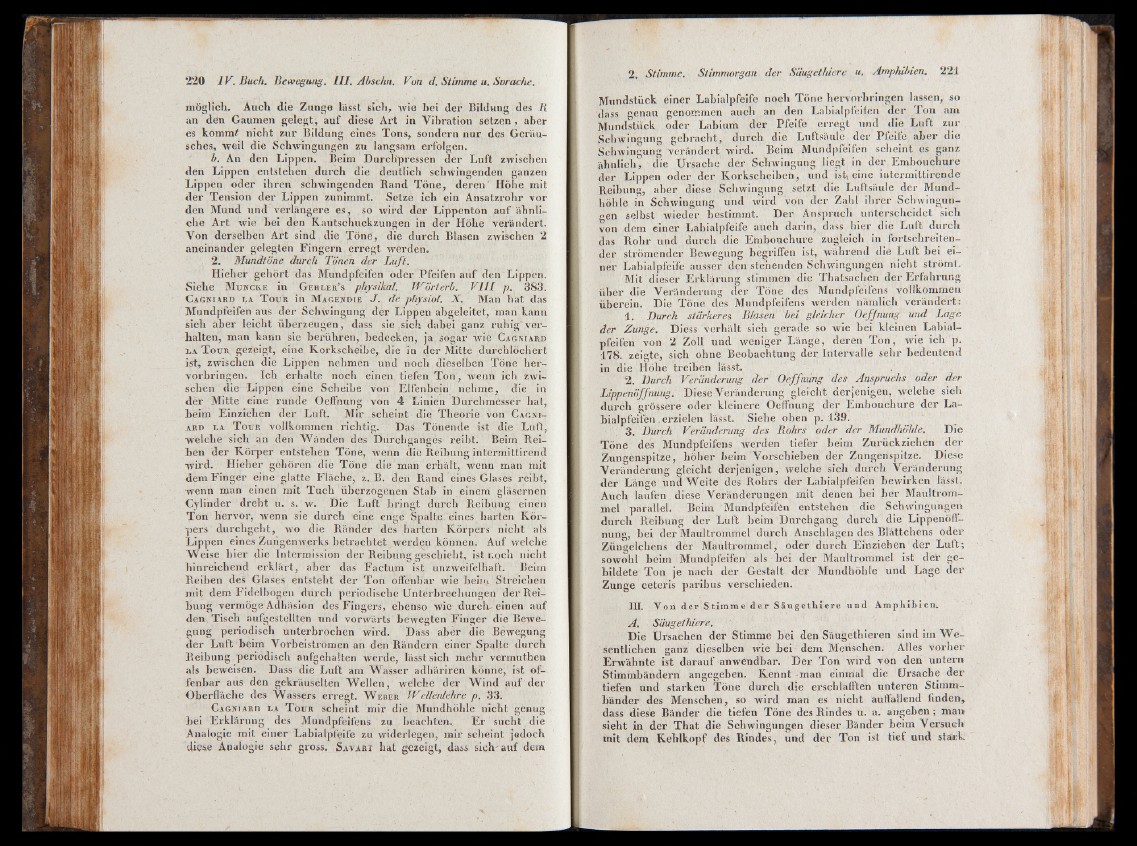
möglich. Auch die Zunge lässt sich, wie hei der Bildung des R
an den Gaumen gelegt, auf diese Art in Vibration setzen , aber
es kommtf nicht zur Bildung eines Tons, sondern nur des Geräusches,
weil die Schwingungen zu langsam erfolgen.
b. An den Lippen. Beim Durchpressen der Luft zwischen
den Lippen entstehen durch die deutlich schwingenden ganzen
Lippen oder ihren schwingenden Band Töne, deren' Höhe mit
der Tension der Lippen zunimmt. Setze ich ein Ansatzrohr vor
den Mund und verlängere es, so wird der Lippenton auf ähnliche
Art wie bei den Kautschuckzungen in der Höhe verändert.
Von derselben Art sind die Töne, die durch Blasen zwischen 2
aneinander gelegten Fingern erregt werden.
2. Mundtöne durch Tönen der Luft.
Hieher gehört das Mundpfeifen oder Pfeifen auf den Lippen.
Siehe Muncke in Gehlbr’s physikal. Wörterb. V III p. 383.
Cagniard la T our in Magendie J. de physiol. X. Man hat das
Mundpfeifen aus der Schwingung der Lippen abgeleitet, man kann
sich aber leicht überzeugen, dass sie sich dabei ganz ruhig'verhalten,
man kann sie berühren, bedecken, ja sogar wie Cagniard
la T our gezeigt, eine Korkscheibe, die in der Mitte durchlöchert
ist, zwischen die Lippen nehmen und noch dieselben Töne her-
vorbringen. Ich erhalte noch einen tiefen Ton', wenn ich zwischen
die Lippen eine Scheibe von Elfenbein nehme, die in
dèr Mitte eine runde OeiFnung von 4 Linien Durchmesser hat,
beim Einziehen der Luft. Mir ,scheint die Theorie von Cagniard
la T our vollkommen richtig. Das Tönende ist die Luft,
welche sich an den Wänden des Durchganges reibt. Beim Reiben
der Körper entstehen Töne, wenn die Reibung intermittirend
wird. Hieher gehören die Töne die man erhält, wenn man mit
dem Finger eine glatte Fläche, z. B. den Rand eines Glases reibt,
wenn man einen mit Tuch überzogenen Stab in einem gläsernen
Cylinder dreht u. s. w. Die Luft bringt durch Reibung einen
Ton hervor, wenn sie durch eine enge Spalte, eines barten Körpers
durchgebt, wo die Ränder des barten Körpers nicht als
Lippen eines Zurigenwerks betrachtet werden können. Auf welche
Weise hier die Intermission der Reibung geschieht, ist noch nicht
hinreichend erklärt, aber das Factum ist unzweifelhaft. Beim
Reiben de§ Glases entsteht der Ton offenbar wie beim Streichen
mit dem Fidelbogen durch periodische Unterbrechungen der Reibung
vermöge Adhäsion des Fingers, ebenso wie durch, einen auf
den Tisch aufgestellten und vorwärts bewegten Finger die Bewegung
periodisch unterbrochen wird. Dass aber die Bewegung
der Luft beim Vorbeiströmen an den Rändern einer Spalte durch
Reibung periodisch aufgehalten werde, lässt sich mehr vermuthen
als beweisen. Dass die Luft am Wasser adhäriren könne, ist offenbar
aus den gekräusölten Wellen, welche der Wind auf der
Oberfläche des Wassers erregt. W eber fVellerdehre p. 33.
CagniARn la T our scheint mir die Mundhöhle nicht genug
bei Erklärung des Mundpfeifens zu beachten. Er sucht die
Analogie mit einer Labialpfeife zu widerlegen, mir scheint jedoch
diese Analogie sehr gross. Savart hat gezeigt, dass sich' auf dem
Mundstück einer Labialpfeife noch Töne hervprbringen lassen, so
dass genau, genommen auch an den Labialptcifen der Ton am
Mundstück oder Labium der Pfeife erregt und die Luft zur
Schwingung gebracht, durch die Luftsäule der Pfeife aber die
Schwingung verändert wird. Beim Mundpfeifen scheint es ganz
ähnlich, die Ursache der Schwingung liegt in der Embouchure
der Lippen oder der Korkscheibeii, und ist* eine intermittirende
Reibung, aber diese Schwingung setzt die Luftsäule der Mundhöhle
in Schwingung und wird von der Zahl ihrer Schwingungen
selbst wieder bestimmt. Der Anspruch unterscheidet sich
von dem einer Labialpfeife auch darin, dass hier die Luft durch
das Rohr und durch die Embouchure zugleich in fortschreitender
strömender Bewegung begriffen ist, während die Luft bei einer
Labialpfeife ausser den stehenden Schwingungen nicht strömt.
Mit dieser Erklärung stimmen die Thatsachen der Erfahrung
über die Veränderung der Töne des Mundpfeitens vollkommen
überein. Die Töne des Mundpfeifens Averden nämlich verändert:
1. Durch stärkeres Blasen bei gleicher Oeffnung und Lage
der Zunge. Diess verhält sich gerade so wie bei kleinen Labialpfeifen
von 2 Zoll und weniger Länge, deren Ton, wie ich p.
178. zeigte, sich ohne Beobachtung der Intervalle sehr bedeutend
in die Höhe treiben lässt. .
2. Durch Veränderung der Oeffnung des Anspruchs oder der
Lippenöffnung; Diese Veränderung gleicht derjenigen, welche sich
durch grössere oder kleinere Oeffnung der Embouchure der Labialpfeifen
, erzielen lässt. Siehe oben p. 139.
3. Durch Veränderung des Rohrs oder der Mundhöhle. Die
Töne des Mundpfeifens werden tiefer beim Zurückziehen der
Zungènspitze, höher beim Vorschieben der Zungenspitze. Diese
Veränderung gleicht derjenigen, welche sich durch Veränderung
der Länge und Weite des Rohrs der Labialpfeifen bewirken lässt.
Auch laufen diese Veränderungen mit denen bei ber Maultrommel
parallel. Beim Mundpfeifen entstehen die Schwingungen
durch Reibung der Luft beim Durchgang durch die Lippenöft-
nung, bei der Maultrommel durch Anschlägen des Blättchens oder
Züngelchens der Maultrommel, oder durch Einziehen der Luit;
sowohl beim Mundpfeifen als bei der Maultrommel ist det gebildete
Ton je nach der Gestalt der Mundhöhle und Lage der
Zunge ceteris paribus verschieden.
III. V o n d e r S t im m e d e r S ä u g e t h i e r e u n d A m p h i b i e n .
A. Säugethiere.
Die Ursachen der Stimme bei den Säugethieren sind im Wesentlichen
ganz dieselben wié bei dem Menschen. Alles vorher
Erwähnte ist darauf anwèndbar. Der Ton wird von den untern
Stimmbändern angegeben. Kennt man einmal die Ursache der
tiefen und starken Töne durch die erschlafften unteren Stimmbänder
des Menschen, so wird man es nicht auffallend finden,
dass diese Bänder die tiefen Töne des Rindes u. a. angeben; man
sieht in der That die Schwingungen dieser Bänder beim Versuch
mit dem Kehlkopf des Rindes, und der Ton ist tief und stark