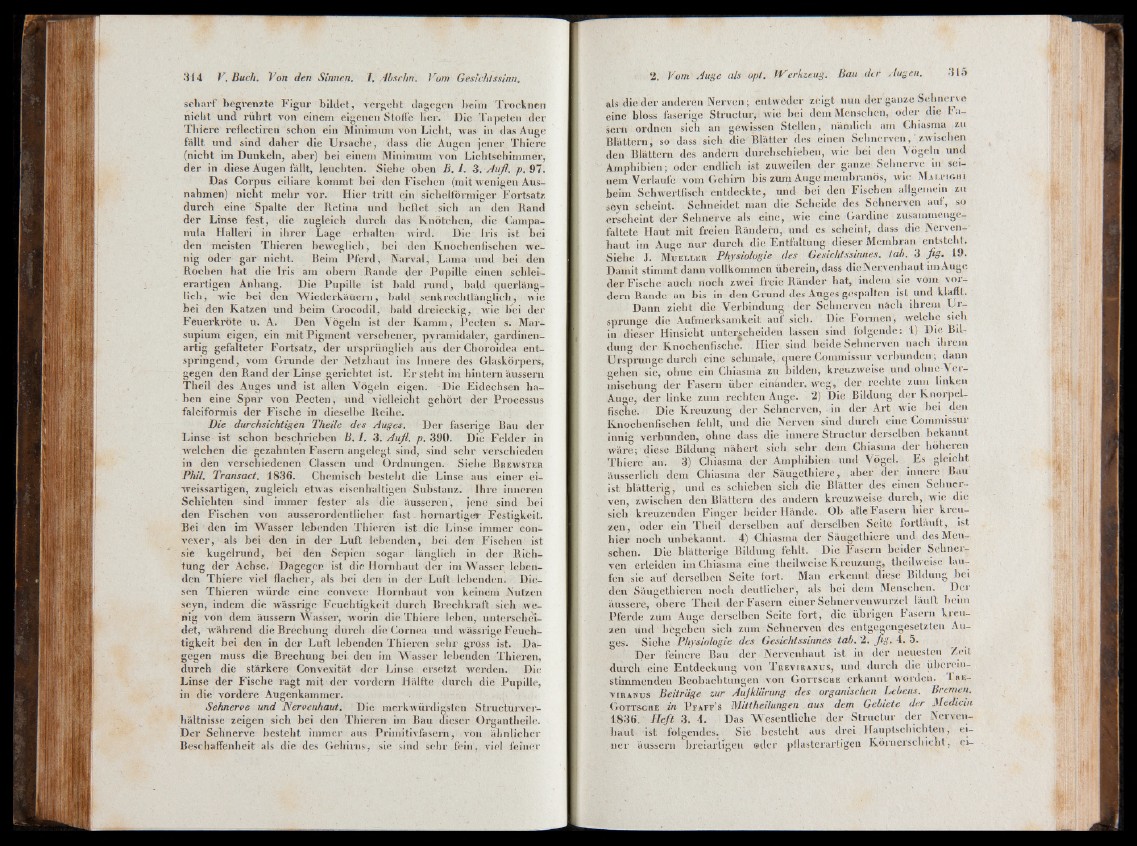
314 V. Buch. Von den Sinnen. I. Ahschn. Vom Gesichtssinn.
scharf begrenzte Figur bildet, vergebt dagegen beim Trocknen
nicht und rührt von einem eigenen Stoffe her. Die Tapeten der
Thiere reflectiren schon ein Minimum von Licht, was in das Auge
fällt und sind daher die Ursache, dass die Augen jener Thiere
(nicht im Dunkeln, aber) bei einem Minimum von Lichtschimmer,
der in diese Augen fällt, leuchten. Siebe oben B. 1. 3. Au fl. p. 97.
Das Corpus ciliare kommt bei den Fiseben (mit wenigen Ausnahmen)
nicht mehr vor. Hier tritt ein sichelförmiger Fortsatz
durch eine Spalte der Retina und hellet sich an den Rand
der Linse fest, die zugleich durch das Knötchen, die Campanula
Halleri in ihrer Lage erhalten- wird. Die Iris ist bei
den meisten Thieren beweglich, bei den Knochenfischen wenig
oder gar nicht. Beim Pferd, Nurval, Lama und bei den
Rochen hat die Iris am obern Rande der Pupille einen schleierartigen
Anhang. Die Pupille ist bald rund) bald querlänglich,
wie bei den Wiederkäuern, bald senkrechtlänglich, wie
bei den Katzen und beim Crocodil, bald dreieckig, wie bei der
Feuerkröte u. A. Den Vögeln ist der Kamm, Pecten s. Mar-
supium eigen, ein mit Pigment versehener, pyramidaler, gardinenartig
gefalteter Fortsatz, der urspi’ünglich aus der Choroidea entspringend,
vom Grunde der Netzhaut ins Innere des Glaskörpers,
gegen den Rand der Linse gerichtet ist. Er steht im hintern äussern
Theil des Auges und ist allen Vögeln eigen. Die Eidechsen haben
eine Spnr von Pecten, und vielleicht gehört der Piocessus
falciformis der Fische in dieselbe Reihe.
Die durchsichtigen Theile des Auges. Der faserige Bau der
Linse- ist schon beschrieben B. I. 3. Aufl. p. 390. Die Felder in
welchen die gezahnten Fasern angelegt sind, sind sehr verschieden
in den verschiedenen Classen und Ordnungen. Siehe Brew' ster
Phil. Transact. 1836. Chemisch besteht die Linse aus einer eiweissartigen,
zugleich etwas eisenhaltigen Substanz. Ihre inneren
Schichten sind immer fester als die äusseren, jene sind bei
dén Fischen von ausserordentlicher fast. hornartiger Festigkeit.
Bei den im Wasser lebenden Thieren ist die Linse immer convexer,
als bei den in der Luft lebenden, bei ulen Fischen ist
sie kugelrund, bei den Sepien sogar länglich in der Richtung
der Achse. Dagegen ist die Hornhaut der im Wasser lebenden
Thiere viel flacher, als bei den in der Luft lebenden. Diesen
Thieren würde eine convexe Hornhaut von keinem Nutzen
seyn, indem die wässrige Feuchtigkeit durch Brechkraft sich wenig
von dem äussern Wasser, worin die Thiere leben, unterscheidet,
während die Brechung durch die Cornea und wässrige Feuchtigkeit
bei den in der Luft lebenden Thieren sehr gross ist. Dagegen
muss die Brechung bei den im Wasser lebenden Thieren,
durch die stärkere Convexität der Linse ersetzt werden. Die
Linse der Fische ragt mit der vordem Hälfte durch die Pupille,
in die vordere Augenkammer.
Sehnerve und Nervenhaut. Die merkwürdigsten Structurver-
hältnisse zeigen sich bei den Thieren im Bau dieser Organtheile.
Der Sehnerve besteht immer aus Primitivfasern, von ähnlicher
Beschaffenheit als die des Gehirns, sie sind sehr fein, viel feiner
2. Vom Auge als opt. kVerkzeug. Bau der felugen. 3 1 5
als die der anderen Nerven ; entweder zeigt nun der ganze Sehnerve
eine bloss faserige Structur, wie bei dem Menschen, oder die Fasern
ordnen sich an gewissen Stellen, nämlich am Chiasma zu
Blättern, so dass sich die'Blätter' des einen Sehnerven, zwischen
den Blättern des andern durchschieben, wie bei den Vögeln und
Amphibien; oder endlich ist zuweilen der ganze Sehnerve in seinem
Verlaufe vom Gehirn bis zum Auge membrunos, wie Mai.i-igih
beim Schwertfisch entdeckte, und bei den Fischen allgemein zu
seyn scheint. Schneidet man die Scheide des Schneiven auf, so
erscheint der Sehnerve als eine, wie eine Gardine zusammengefaltete
Haut mit freien Rändern, und es scheint, dass die Nervenhaut
im Auge nur durch die Entfaltung dieser Membran entsteht.
Siehe J. Mueller Physiologie des Gesichtssinnes, iah. 3 fig. 19.
Damit stimmt dann vollkommen überein, dass dicNervenliaut im Auge
der Fische auch noch zwei freie Ränder hat, indem sie vom vordem
Rande an bis in den Grund des Auges gespalten ist und klafft.
Dann zieht die Verbindung der Sehnerven nach ihrem Ursprünge
die Aufmerksamkeit auf sich. Die Formen, welche sich
in dieser Hinsicht unterscheiden lassen sind folgende: 1) Die Bildung
der Knochenfische. Hier sind beide Sehnerven nach ihrem
Ursprünge durch eine schmale,, quere Commissur verbunden; dann
gehen sie, ohne ein Chiasma zu bilden, kreuzweise und ohne-Vermischung
der Fasern über einander, weg, der rechte zum linken
Auge, der linke zum rechten Auge. 2) Die Bildung der Knorpelfische.
Die Kreuzung der Sehnerven, in der Art wie bei den
Knochenfischen fehlt, und die Nerven sind durch eine Commissur
innig verbunden, ohne dass die innere Structur derselben bekannt
wäre; diese Bildung nähert sich sehr dein Chiasma der höheren
Thiere an. 3) Chiasma der Amphibien und Vögel. Es gleicht
äusserlich dem Chiasma der Säugethiere, aber der innere Bau
ist blätterig, und es schieben sich die Blätter des einen Sehnerven,
zwischen den Blättern des andern kreuzweise durch, wie die
sich kreuzenden Finger beider Hände. Ob alle Fasern hier kieu-
zen, oder ein Theil derselben auf derselben Seite fortläuft, ist
hier noch unbekannt. 4) Chiasma der Säugethiere und des Menschen.
Die blätterige Bildung fehlt. Die Fasern beider Sehnerven
erleiden im Chiasma eine theilweise Kreuzung, theilvveise laufen
sie auf derselben Seite fort. Man erkennt diese Bildung bei
den Säugetbieren noch deutlicher', als bei dem Menschen. Dei
äussere, obere Theil der Fasern einer Sehnervenwurzel läuft beim
Pferde zürn Auge derselben Seite fort, die übrigen Fasern kreuzen
und begeben sich zum Sehnerven des entgegengesetzten Auges.
Siche Physiologie des Gesichtssinnes Iah. 2. fig. 4. 5.
Der feinere Bau der Nervenhaut ist in der neuesten Zeit
durch eine Entdeckung von T revirakus, und durch die übereinstimmenden
Beobachtungen von G ottscre erkannt worden. I be-
viranus Beiträge zur Aufklärung des organischen Lehens. Bremen.
Gottscre ,in P faff’s Mitthedungen aus dem Gebiete der Median
1836. Heft 3. 4. Das Wesentliche der Structur der Nervenhaut
ist folgendes. Sie besieht aus drei Hauptschichten, einer
äussern breiartigen ©der pllasterarLigen Körnerschicht, ei