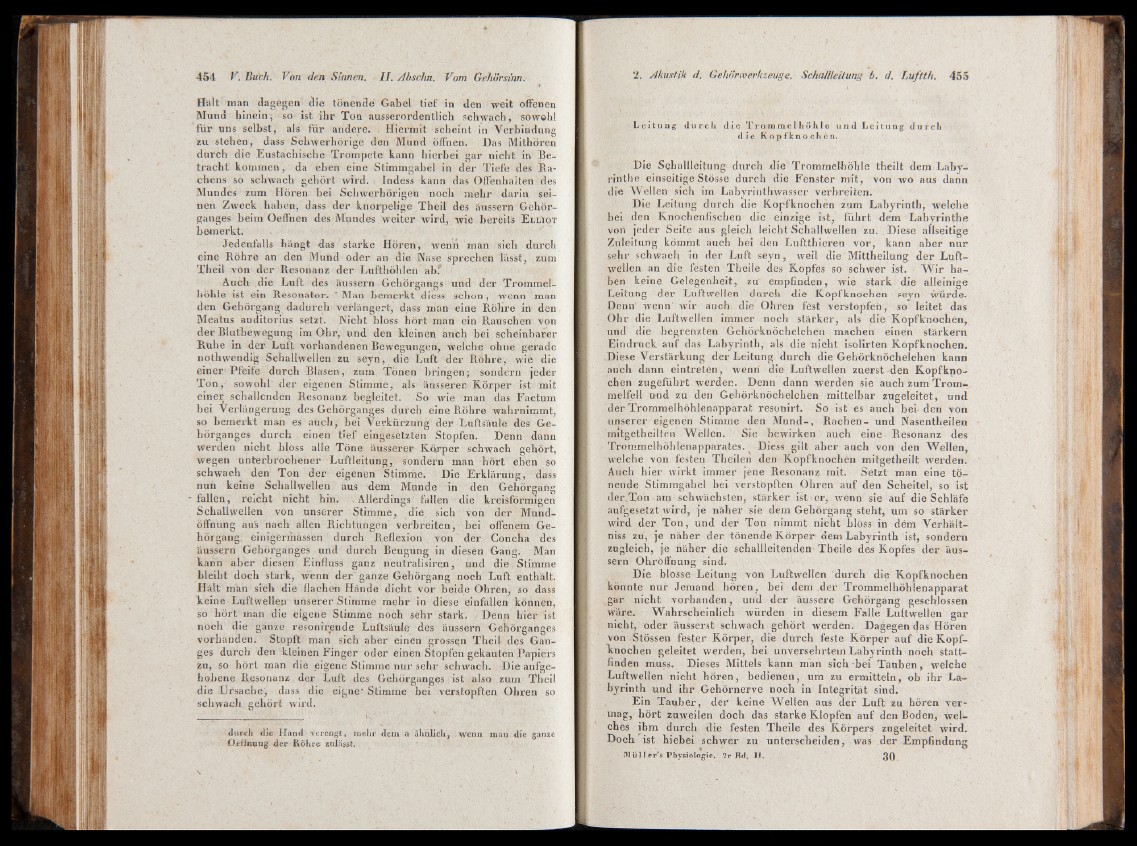
Halt man dagegen die tönende' Gabel tief in den weit offenen
Mund hinein, so ist ihr Ton ausserordentlich schwach, sowohl
für uns selbst,' als für andere. . Hiermit scheint in Verbindung
zu stehen, dass Schwerhörige den Mund öffnen. Das Mithören
durch die Eustachische Trompete kann hierbei gar nicht in Betracht
kommen, da eben eine Stimmgabel in der Tiefe des Rachens
so schwach gehört wird. Indess kann das Offenhalten des
Mundes zum Floren bei Schwerhörigen noch mehr darin seinen
Zweck haben, dass der knorpelige Theil des äussern Gehörganges
beim Oeffnen des Mundes weiter wird, wie bereits E liöot
bemerkt.
Jedenfalls hängt das starke Hören, wenn man sich durch
eine Röhre an den Mund oder an die Nase sprechen lässt, zum
Theil von der Resonanz der Lufthöhlen abf
Auch .die Luft des äussern Gehörgangs und der Trommelhöhle
ist ein Resonator. 1 Man bemerkt diess schon, wenn man
den Gehörgang dadurch verlängert, dass man eine Röhre in den
Meatus auditorius setzt. Nicht bloss hört man ein Rauschen von
der Blutbewegung im Ohr, und den kleinen auch hei, scheinbarer
Ruhe in der Luff vorhandenen Bewegungen. Welche ohne gerade
nöthwendig Schallwellen zu seyn, die Luft der Röhrè, wiè die
einer: Pfeife durch 'Blasen,- zum Tönen bringen; sondern jeder
Tön, sowohl der eigenen Stimrrte, als äusserer Körper ist- mit
einer schallenden Resonanz begleitet. So wie man das Factum
hei Verlängerung des Gehörganges durch eine Röhre währnimmt,
so bemerkt man es auch, bei Verkürzung der Luftsäule des Gehörganges
durch einen tief eingesetzten Stopfen. Denn dann
Werden nicht bloss alle Töne äusserer-' Körper schwach gehört,
wegen unterbrochener Luftleitung, sondern man hört eben so
schwach den Ton der eigenen Stimme. Die Erklärung, dass
nun keine Schallwellen aus dem Munde in den Gehörgang
fallen, reicht nicht hin. .Allerdings fallen die kreisförmigen
Schallwellen von unserer Stimme, die, sich von der Mundöffnung
auS hach allen Richtungen verbreiten, bei offenem Gehörgang
einigermassen durch Reflexion von der Concha des
äussern Gehörganges und durch Beugung in diesen Gang. Man
kann aber diesen Einfluss ganz neutralisiren, und die Stimme
bleibt doch stark, wenn der ganze Gehörgang noch Luft enthält.
Hält man sich die flachen Hände dicht vor beide Ohren, so dass
heine Luftwellen unserer Stimme mehr in diese èinfaflen können,
so hört man die eigene Stimme noch sehr stark. Denn hier ist
noch die gänze resonirende Luftsäule des äussern Gehörganges
vorhanden. Stopft man sich aber einen grossen Theil- des Ganges
durch den kleinen Finger oder einen Stopfen gekauten Papiers
zu, so hört man die eigene Stimme nur sehr schwach. Die aufgehobene
Resonanz der Luft des Gehörganges ist also zum Theil
die Ursache, dass die eigne1 Stimme bei verstopften Ohren so
schwach gehört wird.
durch die Hand verengt, mehr dem a ähnlich, wenn man die ganze
Oeffnung d e r Röhre zulässt.
L e i t u n g d u r c h d i e T r o m m e l h ö h l e u n d L e i t u n g d u r c h
d i e K o p f k n o c h e n .
Die Seballleitung durch die Trommelhöhle tbeilt dem. Labyrinthe
einseitige Stösse durch die Fenster mit, von wo aus dann
die Wellen sich im Labyrinthwasser verbreiten.
Die Leitung durch die Kopfknochen zum Labyrinth, welche
bei den Knochenfischen die einzige ist, führt dem Labyrinthe
von jeder Seife aus gleich leicht Schallwellen zu. Diese allseitige
Zuleitung kömmt auch bei den Luftthieren vor, kann aber nur
sehr schwach in der L,uft seyn, weil die Mittheilung der Luftwellen.
an die festen Theile des Kopfes so schwer ist. s> Wir haben
keine Gelegenheit, zu empfinden, wie stark die alleinige
Leitung der Luftwellen durch die Kopfknochen seyn würde.
Denn' wenn wir auch die Ohren fest yerstopfen, so leitet das
Ohr die Luftwellen immer noch stärker, als die Kopfknochen,
und die begrenzten Gehörknöchelchen machen einen starkem
Eindruck auf das Labyrinth, als die nicht isolirten Kopfknochen.
Diese Verstärkung der Leitung, durch die Gehörknöchelchen kann
auch dann eintreten, wenn die. Luftwellen zuerst--den Kopfknochen
zugeführt werden. Denn dann werden sie auch zum Trommelfell
und zu den Gehörknöchelchen mittelbar zugeleitet, und
der Trommelhöhlenapparat resonirt. So ist es auch bei- den von
unserer eigenen Stimme den Mund-, Rachen- und NasentheiJen
mitgetheilten Wellen. Sie bewirken auch eine Resonanz des
Trommelhöhlenapparates. Diess gilt aber auch von den Wellen,
welche von festen Theilen den Kopfknochen mitgetheilt werden.
Auch hier wirkt immer jene Resonanz mit. Setzt man eine tönende
Stimmgabel bei verstopften Ohren auf den Scheitel, so ist
der,Ton-am schwächsten, stärker ist er, wenn sie auf die Schläfe
aufgesetzt wird, je näher sie dem Gehörgang steht, um so stärker
wird der Ton, und der Ton nimmt nicht bloss in dem Verhäit-
niss zu, je näher der tönende Körper dem Labyrinth ist, sondern
zugleich, je näher die schallleitenden Theile des Kopfes der äussern
Ohröffnung sind.
Die blosse Leitung von Luftwellen 'durch die Kopfknochen
könnte nur Jemand hören, bei dem der Trommelhöhlenapparat
gar nicht vorhanden, und der äussere Gehörgang geschlossen
wäre. Wahrscheinlich würden in diesem Fälle Luftwellen gar
nicht, oder äusserst schwach gehört werden. Dagegen das Hören
von Stössen fester Körper, die durch feste Körper auf die Kopfknochen
geleitet werden, bei unversehrtem Labyrinth noch stattfinden
muss. Dieses Mittels kann man sich bei Tauben, welche
Luftwellen nicht hören, bedienen, um zu ermitteln, ob ihr Labyrinth
und ihr Gehörnerve noch in Integrität sind.
Bin .Tauber, der keine Wellen aus der Luft zu hören vermag,
hört zuweilen doch däs starke Klopfen auf den Boden, welches
ihm durch die festen Theile des Körpers zugeleitet wird.
Doch ist hiebei schwer zu unterscheiden, was der Empfindung
I>1 ÜJI e r’s Physiologie. 2r Bd, II. 3 0