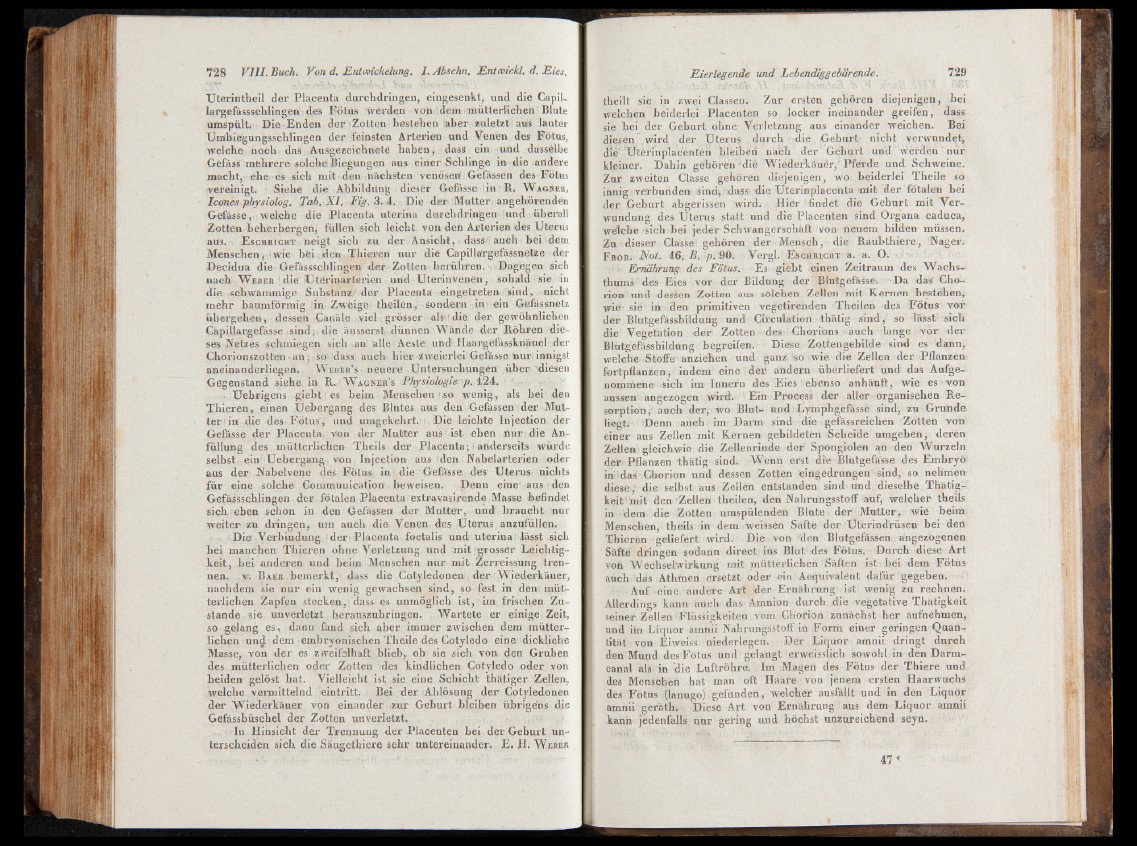
Uterintheil der Placenta durchdringen, eingesenkt, und die CapiL
largefässsehlingen des Fötus werden vop i dem mütterlichen Blute
umspült. DiesEnden der Zotten bestehen aber zuletzt aus lauter
Umbiegungsschlingen der feinsten Arterien und Venen des Fötus,
welche noch das Ausgezeichnete haben, dasS ein und dasselbe
Gèfass mehrere solche Biegungen aus einer Schlinge in die andere
macht, ehe es sieh mit den nächsten vehösen Gefässen des Fötus
vereinigt. 1 Siehe die Abbildung dieser Gefässe in » R. Wagser,
Icones physiolog. Tab. XI. Fig. 3. 4. Die der Mutter-angehörenden
Gefässe, welche die Placenta uterina durchdringen und überall
Zotten beherbergen, füllen sich leicht von den Arterien dés Uterus
aüs.- Eschricrt- neigt sich zu der Ansicht, dass’ auch • bei‘ dem
Menschen, ‘wie bei den Thieren nur die Capillärgefässnetze • der
Decidua die- Gefässschlingen der Zotten berühren.- Dagegen sich
nach .Weber die Uterinarterien und Uterinvenen, sobald sie fh
die schwammige Substanz der Placenta eingetreten sind, nicht
mehr baumförmig in Zweige theilen,; sondern in1 ein Gefässnetz
übergehen, dessen Canäle - viel grösser als*‘die der gewöhnlichen
Gäpillargefässe sind;-die äusserst dünnen ‘Wände der Röhren -dieses
Netzes schmiegen sich an alle? Aeste und* Haargefässknäuel der
Chorionszotten an; so dass auch hier zweierlei Gefässe nur innigst
aneinanderliegen. Weber’s neuere Untersuchungen über diesen
Gegenstand siehe in R. Wagner’s Physiologie 'p. 424. ‘
Uebi'igens giebt es beim- Menschen .so wenig, als bei den
Thieren, einen Üebergang des Blutes aus den Gefässen der-Mutter
in: die des Fötus, und umgekehrt. Die leichte Injeetion der
Gefässe der Placenta, von der Mutter aus ist eben nur dié Anfüllung
des mütterlichen Theils der Placenta; anderseits würde
selbst ein Üebergang von Injeetion aus den Nabelarterien oder
aus der Nabelvene des Fötus in 1 die "Gefässe des' Uterus nichts
für eine solche Gommunication beweisen. Denn eine’ aus den
Gefässschlingen der fötalen Placenta extravasirende Masse befindet
sich eben schon in den Gefässen der Mutter, und braucht nur
weiten zu dringen, um auch die. Venen des -Uterus anztjfüllen.
Die Verbindung • der Placenta foetalis und Uterina lässt sich
bei manchen Thieren ohne Verletzung und mit-grosser Leichtigkeit,
bei anderen und beim Menschen nur mit Zerreissung trennen.
v. Baêr bemerkt, dass die Cotyledonen der Wiederkäuer,
nachdem sie nur ein wenig gewachsen sind, so fest in dem mütterlichen
Zapfen stecken, dass es unmöglich ist, im frischen Zustande
sie unverletzt herauszubringen. Wartete er einige Zeit,
so gelang es, dann fand sich aber immer zwischen dem mütterlichen
und dem embryonischen Theile des Cotyledo eine dickliche
Masse, von der es zweifelhaft blieb, ob sie sich von den Gruben
des mütterlichen oder Zotten des kindlichen Cotyledo oder von
beiden gelöst hat. Vielleicht ist sie eine Schicht thätiger Zellen,
welche vermittelnd eintritt. Bei der Ablösung der Cotyledonen
der Wiederkäuer von einander zur Geburt bleiben übrigens die
Gefässbüschel der Zotten unverletzt.
In Hinsicht der Trennung der Placenten bei der Geburt unterscheiden
sich die Säugethiere sehr untereinander. E. H. W eber
theilt sie in zwei Classen. Zur ersten gehören diejenigen, bei
welchen beiderlei Placenten so locker ineinander greifen, dass
sie bei der Geburt ohne Verletzung aus einander weichen. Bei
diesen wird der Uterus durch die Geburt nicht verwundet-,
die" Uterinplacenteh blëibeii nach der Geburt und' werden nur
kleiner. Dahin gehören'die WIëderkauér, Pferde und Schweine.
Zur zweiten Classe gehören diejenigen, wo beiderlei Theile so
innig ve-rburidewäindi, "dass? -die Uterinplacenta mit der fötalen bei
der Geburt, abgerissen wird. Hier ‘findet die Geburt mit Verwundung
des Uterus statt und die Placenten sind Organa caduca,
welche sich bei jeder Schwangerschaft von neuem bilden müssen.
Zu dieser Classe gehören der Mensch-, •< die Räubthiere, Nager.
Fror .N o t. 46. B. p. 90. Vergl. E schriciit a. a. O.
. .. Ernährung des Fötus. Es; giebt einen Zeitraum des Wachsthums
des Eies vor der Bildung der Blutgefässe'. Da das Chorion
und dessen Zotten aus solchen Zellen mit Kernen bestehen,
wie sie in den primitiven vegetirenden Theilen des Fötus vor
der Blütgefässbildung und Citculation thätig sind, so lässt sieh
die Vegetation der Zotten des ' Choriöns auch lange vor der
Blütgefässbildung begreifen. Diese Zottengebilde sind es dann,
welche Stoffe anziehen und ganz so wié die Zellen der Pflanzen
fortpflanzen, indem eine der andern überliefert und das Aufgenommene
sich im Innern des Eies ebenso anhäuft, wie es von
aussen angezogen wird. Ein Process der aller organischen Resorption,
auch der, wo Blut- und Lymphgefässe sind, zu Gründe
liegt. Denn auch im Darm sind die gefässreicben Zotten von
einer aus Zellen mit Kernen gebildeten Scheide umgeben, deren
Zellen gleichwie die Zellenrinde der Spongiolen an den Wurzeln
der Pflanzen thätig sind. Wenn erst die Blutgefässe des Embryo
in-das1 Ghorion und dessen Zotten eingedrungen sind, so nehmen
diese,' die selbst aus Zellen entstanden; sind Und dieselbe Thätig-
keit mit den Zellen theilen, den Nahrungsstoff auf, welcher theils
in dem die Zotten umspülenden Blute der Mutter, wié beim
Menschen, theils in dem weissen Safte der Uterindrüsen bei den
Thieren geliefert wird. Die -von -den Blutgefässen ungezogenen
Säfte dringen sodann direct ins Blut des Fötus. Durch diese Art
von Wechselwirkung mit mütterlichen Säften ist bei dem Fötus
auch das Athmèri ersetzt oder ein Aequivalént dafür gegeben.
Auf eine andere Art der Ernährung ist wenig zu rechnen.
Allerdings kann auch das-Amnion durch die vegetative Thätigkeit
seiner Zellen Flüssigkeiten vom Gh'orion zunächst her aufnehmen,
und im Liquor amnii Nahrüngsstoff in Form einer geringen Quantität
von Eiweiss niederlegen. Der Liquor amnii dringt durch
den Mund des Fötus und gelangt erwéisslich sowohl in den Darmcanal
als in die Luftröhre. Im Magen des Fötus der Thiere und
des Menschen hat man oft Haare von jenem ersten Haarwuchs
des Fötus (lanugo) gefunden, welcher ausfällt und in den Liquor
amnii geräth. Diese Art von Ernährung aus dem Liquor amnii
kann jedenfalls nur gering und höchst unzureichend seyn.