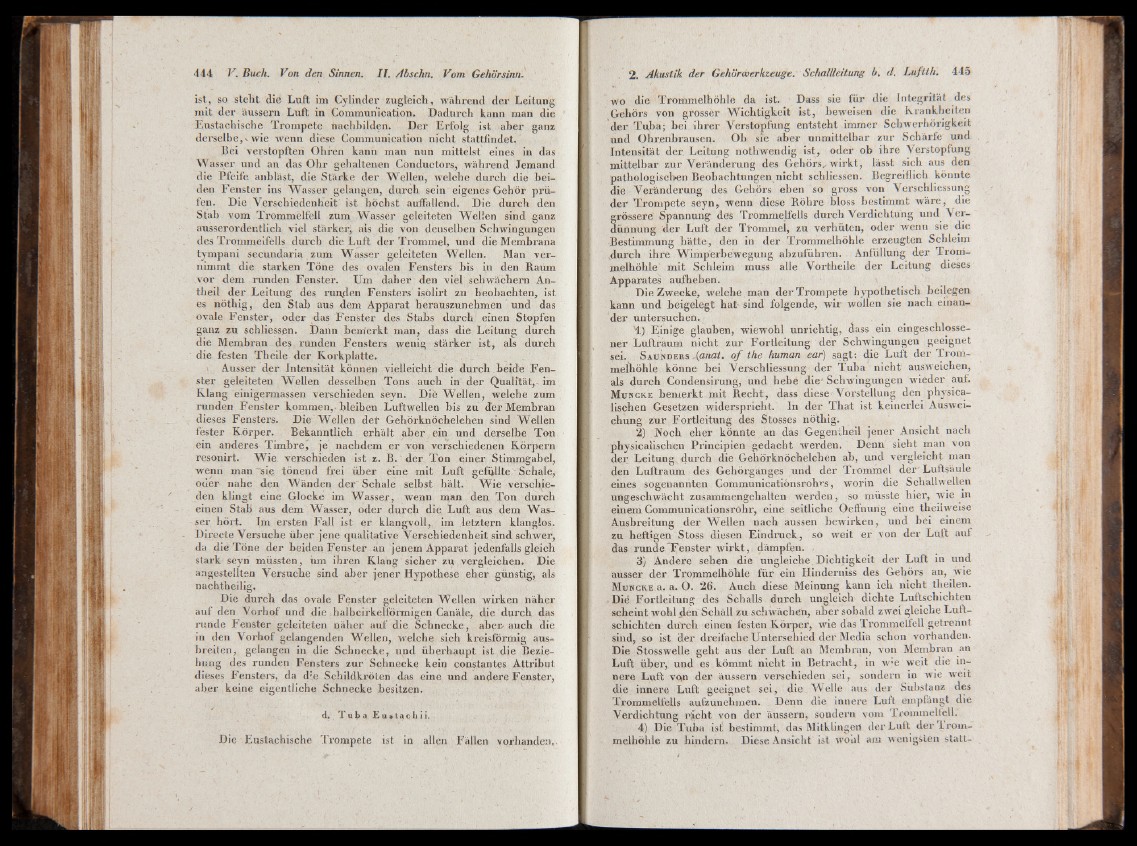
ist, so steht, die Luft im Cylinder zugleich, während der Leitung
mit der äussern Luft in Commuhieation. Dadurch kann man die
Eustachische Trompete nachbilden. Der Erfolg ist aber ganz
derselbe,-wie wenn diese Communication nicht stattfindet.
Bei verstopften Ohren kann man nun mittelst eines in das
Wasser und an das Ohr gehaltenen Cönductors, während Jemand
die Pfeife anhläst, die Stärke der Wellen, welche durch die beiden
Fenster ins Wasser gelangen, durch sein 'eigenes Gehör prüfen.
Die Verschiedenheit ist höchst auffallend. Die durch den
Stab vom Trommelfell zum Wasser geleiteten Wellen sind ganz
ausserordentlich viel stärker^ als die von denselben Schwingungen
des Trommelfells durch die Luft der Trommel, ünd die Membrana
tympani secundaria zum Wasser geleiteten Wellen. Man vernimmt
die starken Töne des ovalen Fensters bis in den Raum
vor dem runden Fenster. Um daher den viel schwächern An-
theil der Leitung des runden Fensters'isolirt zu beobachten, ist
es nöthig, den Stab aus dem Apparat herauszunehmen und das
ovale Fenster, oder das Fenster des Stabs durch einen Stopfen
ganz zu schliessen. Dann bemerkt man, dass die Leitung durch
die Membran des runden Fensters wenig stärker ist, als durch
die festen Theile der Korkplatte.
Ausser der Intensität können vielleicht die durch beide Fenster
geleiteten Wellen desselben Tons , auch in der Qualität,-im
Klang einigermassen verschieden seyn. Die Wellen, welche zum
runden Fenster kommen,, bleiben Luftwellen bis zu der Membran
dieses Fensters. Die Wellen der Gehörknöchelehen sind Wellen
fester Körper. Bekanntlich erhält aber ein und derselbe Ton
ein anderes Timbre J je nachdem er von verschiedenen Körpern
resonirt. W ie verschieden ist z. B. der. Ton einer Stimmgabel,
wenn man "sie tönend frei über eine mit Luft gefüllte Schale,
oder nahe den Wänden der" Schale selbst hält. Wie verschieden
klingt eine Glocke im Wasser, wenn man den Ton durch
einen Stab aus dem Wasser, oder durch die Luft aus dem Wasser
hört. Im ersten Fall ist er klangvoll,, im letztem klanglos.
Directe Versuche über jene qualitative Verschiedenheit sind schwer,
da die Töne der beiden Fenster an jenem Apparat jedenfalls gleich
stark seyn müssten, um ihren Klang sicher zu vergleichen. Die
angestellten Versuche sind aber jener Hypothese eher günstig, als
nacbtheilig.
Die durch das ovale Fenster geleiteten Wellen wirken näher
auf den Vorhof und die halbcirkelförmigen Canäle, die durch das
runde Fenster geleiteten näher auf die Schnecke, aber- auch die
in den Vorhof gelangenden Wellen, welche sich kreisförmig ausbreiten,
gelangen in die Schnecke, und überhaupt ist die Beziehung
des runden Fensters zur Schnecke kein constantes Attribut
dieses Fensters, da die Schildkröten das eine und andere Fenster,
aber keine eigentliche Schnecke besitzen.
d., T u a Eu *tach ii.
Die Eustachische Trompete ist in allen Fällen vorhanden,.
wo die Trommelhöhle da ist. Dass sie für die Integrität des
Gehörs von grossèr Wichtigkeit ist, beweisen die Krankheiten
der Tnba; bei ihrer Verstopfung entsteht immer Schwerhörigkeit
und Ohrenbrausen. Ob sie aber unmittelbar zur Schärfe und
Intensität der Leitung nothwendig ist, oder ob ihre Verstopfung
mittelbar zur Veränderung des Gehörs, wirkt, lässt sich aus den
pathologischen Beobachtungen.nicht schliessen. Begreiflich könnte
die Veränderung des Gehörs eben so gross von Verschliessung
der Trompete seyn, wenn diese Röhre bloss bestimmt wäre, die
grössere' Spannung des Trommelfells durch Verdichtung und Verdünnung
der Luft der Tfommei, zu verhüten, oder wenn sie die
Bestimmung hätte, den in der Trommelhöhle erzeugten Schleim
.durch ihre Wimperbewegung abzuführen. Anfüllung der Trommelhöhle'
mit Schleim muss alle Vortheile der Leitung dieses
Apparates aufheben.
DieZwecke, welche man der Trompete hypothetisch beilegen
kann und beigelegt hat sind folgende, wir wollen sie nach einander
untersuchen.-
'Ij Einige glauben, wiewohl unrichtig, dass ein eingeschlossener
Luftraum nicht zur Fortleitung der Schwingungen geeignet
sei. S atjnders .{anat. o f ihe human ear) sagt: die Luft der Trommelhöhle
könne bei Verschliessung der Tuba nicht ausweichen,
als durch Condensirung, und hebe die' Schwingungen wieder auf.
Mukcke bemerkt,mit Recht, dass diese'Vorstellung den physica-
lischen Gesetzen widerspricht. In der That ist keinerlei Ausweichung
zur Fortleitung des Stossps nöthig.
2) Noch eher könnte an das Gegentheil jener Ansicht nach
physicalischen Principien gedacht werden. Denn sieht man von
der Leitung durch die Gehörknöchelchen ah, und vergleicht man
den Luftraum des Gehörganges und der Trommel der'Luftsäule
eines sogenannten Communicatiönsrohrs, worin die Schallwellen
ungeschwächt zusammengehalten werden, so müsste hier, wie in
einem Communicationsröhr, eine seitliche Qeffnung eine theilweise
Ausbreitung der Wellen nach aussen bewirken, und bei einem
zu heftigen Stoss diesen Eindruck, so weit er von der Luft auf
das runde Fenster wirkt, dämpfen. .
3) Andere sehen die ungleiche , Dichtigkeit der Luft in und
ausser der Trommelhöhle für ein Hinderniss des Gehörs an, wie
Muncke a. a. O. 2 6 . Auch diese Meinung kann ich nicht theilen.
Dié Fortleitung des Schalls durch ungleich dichte Luftschichten
scheint wohl den Schall zu schwächeü, aber sobald zwei gleiche Luftschichten
durch einen festen Körper, wie das Trommelfell getrennt
sind, so ist der dreifache Unterschied der Media schon vorhanden.
Die Stosswelle geht aus der Luft an Membran, von Membran an
Luft über, und es kömmt nicht in Betracht, in w'’e weit die innere
Luft vo>n der äussern verschieden sei, sondern in wie weit
die innere Luft geeignet sei, die Welle aus der Substanz des
Trommelfells aufzunehmen. Denn die innere Luft empfängt die
Verdichtung nicht von der äussern, sondern vom Trommelfell.
4) Die Tuba ist bestimmt, das Mitklingeil der Luft der Trommelhöhle
zu hindern. Diese Ansicht ist woiil am wenigsten statt