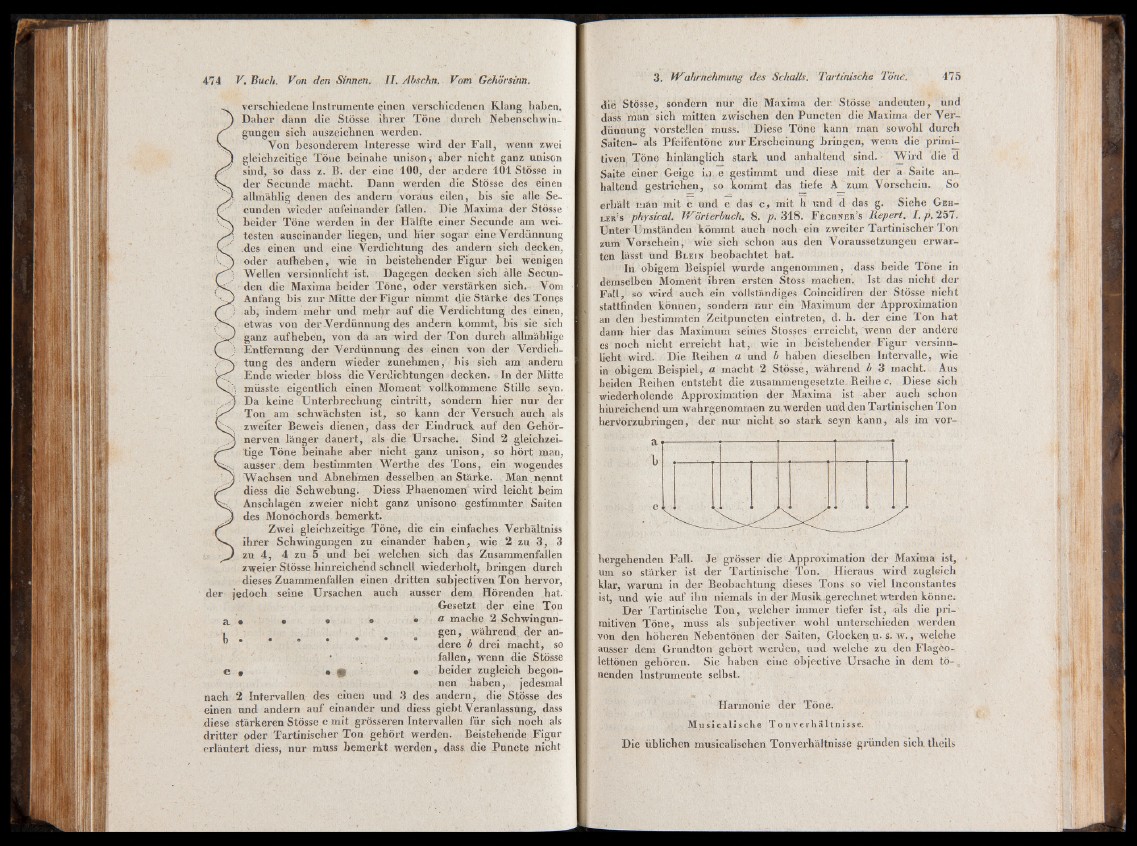
verschiedene Instrumente ^inen verschiedenen Klang haben.
Daher dann die Stösse ihrer Töne durch Nebenschwingungen
sich auszeichnen werden.
Von besonderem Interesse wird der Fall, wenn zwei
gleichzeitige Töne beinahe unisony aber nicht ganz unison
sind, So dass z. B. der eine 100, der andere 101 StÖsse in
der Secunde macht. Dann werden die Stösse des einen
allmählig denen des andern voraus eilen, bis sie alle Seconden
wieder aufeinander fallen. Die Maxima der Stösse
beider Töne werden, in der Hälfte einer Secunde am weitesten
auseinander liegen, und hier sogar eine Verdünnung
-des einen und eine Verdichtung des andern sich decken,
oder aufheben, wie in beistehender Figur bei wenigen
Wellen versinnlicht ist. Dagegen decken sich alle Secun-
■ den die Maxima beider Töne, oder verstärken sich. Vom
Anfang bis zur Mitte der Figur nimmt die Stärke des Tones
ab, indem mehr und mehr auf die Verdichtung des einen,
etwas von der Verdünnung des andern kommt, bis sie sich
ganz aufheben, von da an wird der Ton durch allmählige
Entfernung der Verdünnung des einen von der Verdichtung
des andern wieder zunehmen, bis sich: am' andern
Ende wieder bloss die Verdichtungen decken. - In dér Mitte
müsste eigentlich einen Moment vollkommene Stille seyn.
Da keine Unterbrechung cintritt, sondern hier nur der
Ton am schwächsten ist, so kann der Versuch auch als
zweiter Beweis dienen, dass der Eindruck auf den Gehörnerven
länger dauert, als die Ursache. Sind 2 gleichzeitige
Töne beinahe aber nicht ganz unison, so hört man,
ausser ..dem bestimmten Werthe des Tons, ein wogendes
Wachsen und Abnehmen desselben 'an Stärke. Man nennt
diess die Schwebung. Diess Phaenomen wird leicht beim
Anschlägen zweier nicht ganz unisono gestimmter Saiten
des Monochords bemerkt.
Zwei gleichzeitige Töne, die ein einfaches Verhältnis
ihrer Schwingungen zu einander haben, wie 2 zu 3, 3
zu 4, 4 zu 5 und bei welchen sich das Zusammenfallen
zweier Stösse hinreichend schnell wiederholt, bringen durch
dieses Zuammenfallen einen. dritten subjectiven Ton hervor,
der jedoch seine Ursachen auch ausser dem Hörenden hat.
Gesetzt der eine Ton
\ • • • • a mache 2 Schwingun-
1 gen, während, der an-
” * * * * i der e i drei macht, so
• fallen, wenn die Stösse
c • * m • beider zugleich begonnen
haben, jedesmal
nach 2 Intervallen des einen und 3 des andern, die Stösse des
einen und andern auf einander und diess.giebtVeranlassung, dass
diese stärkeren Stösse c mit grösseren Intervallen für sich noch als
dritter oder Tartinischer Ton gehört werden. Beistehende Figur
erläutert diess, nur muss bemerkt werden, dass die Puncte nicht
die Stösse, sondern nur die Maxima der, Stösse andeuten, und
dass man sich mitten zwischen den Puncten die Maxima der Verdünnung
vorstellen muss. Diese Töne kann man sowohl durch
Saiten- als Pfeifentöne zur Erscheinung bringenj wenn die primitiven,
Töne hinlänglich stark und anhaltend sind. - Wird die d
Saite einer Geige i.i.e gestimmt und diese mit der a Saite anhaltend
gestrichen, so kommt das tiefe A_zum Vorschein. So
erhält män mit c und e das C, mit h und d das g. Siehe Geh-
uer!s physical. Wörterbuch. 8. p. 318. F echner’s Repert. I. p. 257.
Unter Umständen kömmt auch noch ein zweiter Tartinischer Ton
zürii Vorschein, wie sich schon aus den Voraussetzungen erwarten
lässt und Blein beobachtet hat.
In obigem Beispiel Wurde angenommen, dass beide Töne in
demselben Moment ihren ersten Stoss machen. Ist das nicht der
Fall, so wird auch, ein vollständiges Coincidiren der Stösse nicht
stattfinden können, sondern nur ein Maximum der Approximation
an den bestimmten Zeitpuncten eintreten, d. h. der eine Ton hat
dann hier das Maximum seines Stosses erreicht, wenn der andere
es noch nicht erreicht hat, wie in beistehender Figur versinnlicht
wird. Die Beihen a und b haben dieselben Intervalle, wie
in obigem Beispiel, a macht 2 Stösse, während b 3 macht. Aus
beiden Reihen entsteht die zusammengesetzte- Reihe c. Diese sich
wiederholende Approximation der Maxima - ist aber auch schon
hinreichend um wahrgenommen zu werden und den Tartinischen Ton
herVorzubringen, der nur nicht so stark seyn kann, als im vorhergehenden
Fall. Je grösser die Approximation der Maxima ist,
um so stärker ist der Tartinische Ton. Hieraus wird zugleich
klar, warum in der Beobachtung dieses Tons so viel Inconstantes
ist, und wie auf ihn niemals in der Musik,gerechnet werden könne;
Der Tartinische Ton, welcher immer tiefer ist, -als die primitiven
Töne, muss als subjectiver wohl unterschieden werden
von den höheren Nebentönen der Saiten, Glocken u. S. w., welche
ausser dem Grundton gehört werden, und welche zu den Flagèo-
lettönen gehören. Sie haben eine objective Ursache in dem tö-,
nenden Instrumente selbst.
Harmonie der Töne.
M u s i c a l l s e h e T o n Verhäl t n i s s e .
Die üblichen musicalischèn Tonverhältnisse gründen sich, theils