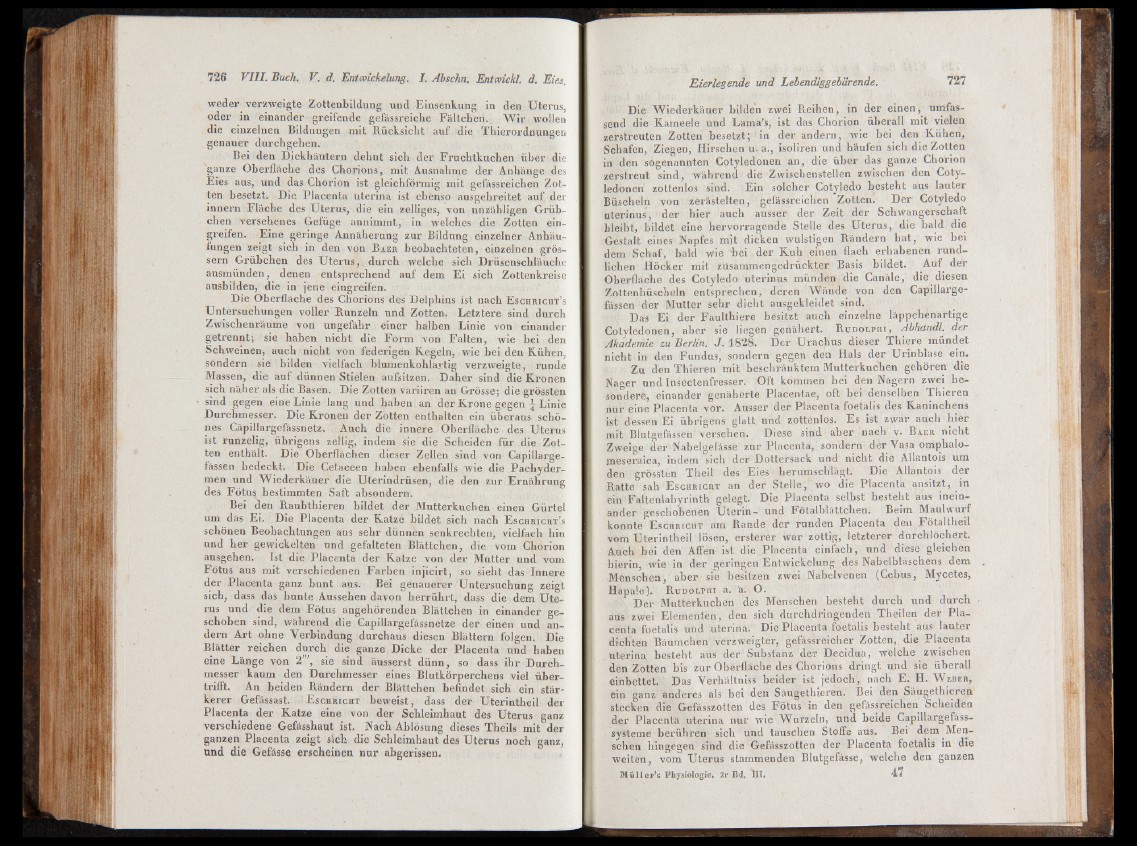
weder verzweigte Zottenbildung und Einsenkung in den Uterus,
oder in einander greifende gefässreiche Fältchen. Wir wollen
die einzelnen Bildungen mit Rücksicbt auf die Thierordnungen
genauer durchgehen.
Bei den Dickhäutern dehnt sich der Fruchtkuchen über die
ganze Oberfläche des Chorions, mit Ausnahme der Anhänge des
Eies aus, und das Chorion ist gleichförmig mit gefässreichen Zotten
besetzt. Die Placenta uterina ist ebenso ausgebreitet auf der
innern Fläche des Uterus, die ein zeitiges, von unzähligen Grübchen
versehenes Gefüge annimmt, in welches die Zotten ein-
greifen. Eine geringe Annäherung zur Bildung einzelner Anhäufungen
zeigt sich in den von Baer beobachteten, einzelnen grossem
Grübchen des Uterus, durch welche sich Drüsenschläuche
ausmünden, denen entsprechend auf dem Ei sich Zottenkreise
ausbilden, die in jene eingreifen.
Die Oberfläche des Choriöns des Delphins ist nach E schricht’s
Untersuchungen voller Runzeln und Zotten. Letztere sind durch
Zwischenräume von ungefähr einer halben Linie von einander
getrennt; sie haben nicht die Form von Falten, wie bei den
Schweinen, auch nicht von federigen Kegeln, wie bei den Kühen,
sondern sie bilden vielfach blumenkohlartig verzweigte, runde
Massen, die auf dünnen Stielen aufsitzen. Daher sind die Kronen
sich näher als die Basen. Die Zotten variiren an Grösse; die grössten
sind gegen eine Linie lang und haben an der Krone gegen i Linie
Durchmesser. Die Kronen der Zotten enthalten ein überaus schönes
Cäpillargefässnetz. Auch die innere Oberfläche des Uterus
ist runzelig, übrigens zellig, indem Sie die Scheiden für die Zotten
enthält. Die Oberflächen dieser Zellen sind von Capillarge-
fässen bedeckt. Die Cetaceen haben ebenfalls wie dié Pachydermen
und Wiederkäuer die Uterindrüsen, die den zur Ernährung
des Fötus bestimmten Saft absondern.
Bei den Raubthieren bildet der Mutterkuchen einen Gürtel
um das Ei. Die Placenta der Katzè bildet sich nach E schricht’s
schönen Beobachtungen aus sehr dünnen senkrechten, vielfach hin
und her gewickelten und gefalteten Blättchen, die vom Chorion
ausgehen. Ist die Placenta der Katze von der Mutter und vom
Fötus aus mit verschiedenen Farben injicirt, so sieht das Innere
der Placenta ganz bunt aus. Bei genauerer Untersuchung zeigt
sich, dass das bunte Aussehen davon herrührt, dass die dem Uterus
und die dem Fötus angehörenden Blättchen in einander geschoben
sind, während die Gapillargefässnetze der einen und andern
Art ohne Verbindung durchaus diesen Blättern folgen. Die
Blätter reichen durch die ganze Dicke der Placenta und haben
eine Länge von 2'", ■ sie sind äusserst dünn, so dass ihr Durchmesser
kaum den Durchmesser eines Blutkörperchens viel übertrifft.
An beiden Rändern der Blättchen befindet sich ein stärkerer
Gefässast. E schricht beweist, dass der Uterintheil der
Placenta der Katze eine von der Schleimhaut des Uterus ganz
verschiedene Gefässhaut ist. Nach Ablösung dieses Theils mit der
ganzen Placenta zeigt sich die Schleimhaut des Uterus noch ganz,
und die Gefässe erscheinen nur abgerissen.
Die Wiederkäuer bilden zwei Reiben, in der einen, umfassend
die Kameele und Larna’s, ist das Chorion überall mit vielen
zerstreuten Zotten besetzt; in der andern, wie bei den Kühen,
Schafen, Ziegen, Hirschen u. a., isoliren und häufen sich die Zotten
in den sogenannten Cotyledonen an, die über das ganze Chorion
zerstreut sind, während die Zwischenstellen zwischen den Cotyledonen
zottenlos sind. Ein solcher Cotyledo besteht aus lauter
Büscheln von zerästelten, gefässreichen Zotten. Der Cotyledo
uterinus, der hier auch ausser der Zeit der Schwangerschaft
bleibt, bildet eine hervorragende Stelle des Uterus, die bald die
Gestalt eines Napfes mit dicken wulstigen Rändern hat, wie bei
dem Schaf, bald wie "hei der Kuh einen flach erhabenen rundlichen
Höcker mit züsammengedrückter Basis bildet. Auf der
Oberfläche des Cotyledo uterinus münden die Canäle, die diesen
Zottenbüscheln entsprechen, deren Wände von den Capillarge-
fässen der Mutter sehr dicht ausgekleidet sind.
Das Ei der Faulthiere besitzt auch einzelne läppchenartige
Cotyledonen, aber sie liegen genähert. R u d o l p iii, Abhandl. der
Akademie zu Berlin. J. 1828. Der Urachus dieser Thiere mündet
nicht in den Fundus, sondern gegen den Hals der Urinblase ein.
Zu den Thieren mit beschränktem Mutterkuchen gehören die
Nager und Insectenfresser. Oft kommen bei den Nagern zwei besondere,
einander genäherte Placentae, oft bei denselben Thieren
nur eine Placenta vor. Ausser der Placenta foetalis des Kaninchens
ist dessen Ei übrigens glatt, und zottenlos. Es ist zwar auch hier
mit Blutgefässen versehen. Diese sind aber nach v. B aer nicht
Zweige der Nabelgefässe zur Placenta, sondern der Vasa omphalo-
meseraicä, indem sich der Dottersack und nicht die Allantois um
den grössten Thed des Eies herumschlägt. Die Allantois der
Ratte sah EscHRicnT an der Stelle, wo die Placenta ansitzt, in
ein Faltenlabyrinth' gelegt. Die Placenta selbst besteht aus ineinander
geschobenen Uterin- und Fötalblättchen. Beim Maulwurf
konnte E schricht am Rande der runden Placenta den .Fotaltheil
vom Uterintheil lösen, ersterer war zottig, letzterer durchlöchert.
Auch bei den Affen ist die Placenta einfach, und diese gleichen
hierin wie in der geringen Entwickelung des Nabelbläschens dem
Menschen, aber sie besitzen zwei Nabeivenen (Gebus, Mycetes,
Hapale). R udolphi a. ä. O.
Der Mutterkuchen des Menschen besteht durch und durch
aus zwei Elementen, den sich durchdringenden Theilen der Placenta
foetalis und uterina. Die Placenta foetalis besteht aus lauter
dichten Bäumchen verzweigter, gefässreicher Zotten, die Placenta
uterina besteht aus der Substanz der Decidua, welche zwischen
den Zotten bis zur Oberfläche des Chorions dringt und sie überall
einbettet. Das Verhältniss beider ist jedoch, nach E. H. W eber,
ein ganz anderes als bei den Säugethieren. Bei den Säugethieren
stecken die Gefässzotten des Fötus in den gefässreichen Scheiden
der Placenta uterina nur wie Wurzeln, und beide Capillargefäss-
systeme berühren sich und tauschen Stoffe aus. Bei dem Menschen
hingegen sind die Gefässzotten der Placenta foetalis in die
weiten, vom Uterus stammenden Blutgefässe, welche den ganzen
M ü l le r ’s Physiologie. 2r Bd, UI. 47