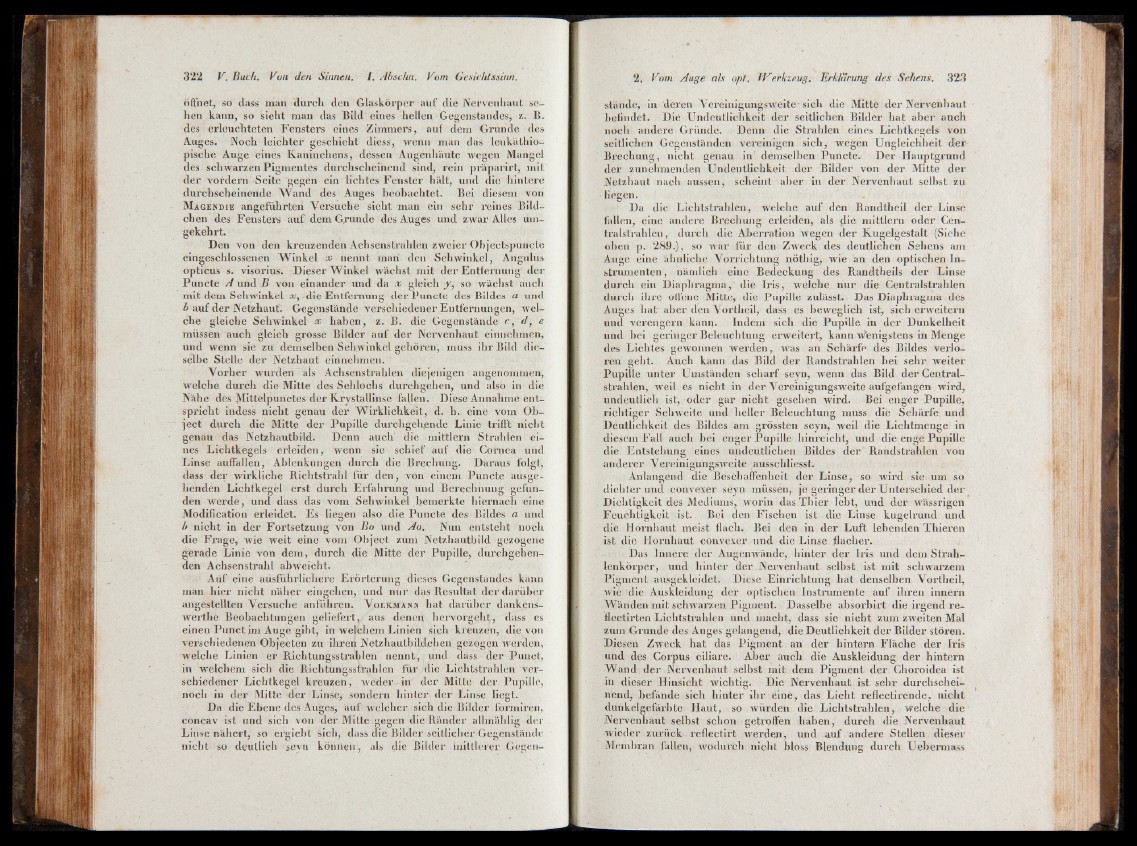
öffnet, so dass man durch den Glaskörper auf die Nervenhaut sehen
kann, so sieht man das Bild eines hellen Gegenstandes, z. B.
des erleuchteten Fensters eines Zimmers, auf dem Grunde des
Auges. Noch leichter geschieht diess, wenn man das leukäthio-
pische Auge eines Kaninchens, déssen Augenhäute wegen Mangel
des schwarzen Pigmentes durchscheinend sind, rein präparirt, mit
der vordem Seite gegen ein lichtes Fenster hält, und die hintere
durchscheinende Wand des Auges beobachtet. Bei diesem von
Magekdie angeführten Versuche sieht man ein sehr reines Bildchen
des Fensters auf dem Grunde des Auges und zwar Alles umgekehrt.
Den von den kreuzenden Achsenstrahlen zweier Objectspuncte
eingeschlossenen Winkel x nennt man den Sehwinkel, Angulus
opticus s. visorius. Dieser Winkel wächst mit der Entfernung' der
Puncte A und B von einander und da x gleich y, so wächst auch
mit dem Sehwinkel x , . die Entfernung der Puncte des Bildes a und
b auf der Netzhaut. Gegenstände verschiedener Entfernungen, welche
gleiche Sehwinkel x haben, z. B. die Gegenstände c, d, e
müssen auch gleich grosse Bilder auf der Nervenhaut einnchmen,
und wenn sie zu demselben Sehwinkel gehören, muss ihr Bild dieselbe
Stelle der Netzhaut einnehmen.
Vorher wurden als Achsenstrahlen diejenigen angenommen,
welche durch die Mitte des Selilochs durchgehen, und also in die
Nähe des Mittelpunctes der Krystallinse fallen. Diese Annahme entspricht
indess nicht genau der Wirklichkeit, d. h. eine vom Object
durch die Mitte der Pupille durchgehende Linie trifft nicht
genau das Netzhautbild. Denn auch die mittlern Strahlen eines
Lichtkegels erleiden, wenn sie schief auf die Cornea und
Linse auffallen, Ablenkungen durch die Brechung. Daraus folgt,
dass der wirkliche Richtstrahl für den, von einem Puncte ausgehenden
Lichtkegel erst durch Erfahrung und Berechnung gefunden
werde, und dass das vom Sehwinkel bemerkte hiernach eine
Modification erleidet. Es liegen also-die Puncte des Bildes a und
h nicht in der Fortsetzung von Bo und Ao. Nun entsteht noch
die Frage, wie weit eine vom Object zum Netzhautbild gezogene
gerade Linie von dem, durch die Mitte der Pupille, durchgehenden
Achsenstrahl abweicht.
Auf eine aüsfuhrlichere Ei’örterung dieses Gegenstandes kann
man hier nicht näher eingehen, und nur das Resultat der darüber
angestellten Versuche anführen. Volkmarm hat darüber dankens-
wertlie Beobachtungen geliefert, aus denen hervorgeht, dass es
einen Punct im Auge gibt, in welchem Linien sich kreuzen, die von
verschiedenen Objecten zu ihren Netzhautbildehen gezogen werden,
welche Linien er Richtungsstrahlen nennt, und dass der Punct,
in welchem sich die Richtungsstrahlen für die Lichtstrahlen verschiedener
Lichtkegel kreuzen, weder in der Mitte der. Pupille,
noch in der Mitte der Linse, sondern hinter der Linse liegt.
Da die Ebene des Auges, auf welcher sich die Bilder formirèn,
concav ist und sich von der Mitte gegen die Ränder allmäblig der
Linse nähert, so ergiebt sieb, dass die Bilder seitlicher Gegenstände
nicht so deutlich sevn können, als die Bilder mittlerer Gegenstände,
in deren Vereinigungsweite' sich die Mitte der Nervenhaut
befindet. Die Undeutlichkeit der seitlichen Bilder hat aber auch
noch andere Gründe; Denn die Strahlen eines Lichtkegels von
seitlichen Gegenständen vereinigen sich, wegen Ungleichheit der
Brechung, nicht genau in' demselben Puncte. Der Hauptgrund
der zunehmenden Undeutlichkeit der Bilder von der Mitte der
Netzhaut nach aussen, scheint aber in der Nervenhaut selbst zu
■ liegen.
Da die Lichtstrahlen, welche auf den Randtheil der Linse
fallen, eine andere Brechung erleiden, als (die mittlern oder Centralstrahlen
, durch die Aberration wegen der Kugelgestalt (Siehe
oben p. 289.), so war für den Zweck des deutlichen Sehens am
Auge eine ähnliche Vorrichtung nötbig, wie an den optischen Instrumenten,
nämlich eine Bedeckung des Randtheils der Linse
durch ein Diapln*agma,' die Iris, welche nur die Centralstrahlen
durch ihre offene Mitte, die Pupille zulässt. Das Diaphragma des
Auges bat aber den Vortheil, dass es beweglich ist, sich erweitern
und verengern kanp. Indem sich die Pupille in der Dunkelheit
und bei geringer Beleuchtung erweitert, kann wenigstens in Menge
des Lichtes gewonnen werden, was an Schärfe des Bildes verloren
geht. Auch kann das Bild der Randstrahlen bei sehr weiter
Pupille unter Umständen scharf seyn, wenn das Bild der Centralstrahlen,
Aveil es nicht in der Vereinigungsweite aufgefangen wird,
undeutlich ist, oder gar nicht gesehen wird. Bei enger Pupille,
richtiger Sehweite und heller Beleuchtung muss dié Schärfe und
Deutlichkeit des Bildes am grössten seyn, weil die Lichtmenge in
diesem Fall auch bei enger Pupille hinreicht, und die enge Pupille
die Entstehung eines undeutlichen Bildes der Randstrahlen von
anderer Vereinigungsweite ausschliesst.
Anlangend die Beschaffenheit der Linse, so wird sie um so
dichter und convexer seyn müssen, je geringer der Unterschied der
Dichtigkeit des Mediums, worin das Thier lebt, und der wässrigen
Feuchtigkeit ist. Bei den Fischen ist die Linse kugelrund und
die Hornhaut meist flach. Bei den in der Luft lebenden Thieren
ist die Hornhaut convexer und die Linse flacher.
Das Innere der Augenwände, hinter der Iris und dem Strahlenkörper,
und hinter der Nervenhaut selbst ist mit schwarzem
Pigment ausgekleidet. Diese Einrichtung hat denselben Vortbeil,
Avie die Auskleidung der optischen Instrumente auf ihren innern
Wänden mit schwarzen. Pigment. Dasselbe absorbirt die irgend re-
flectirten Lichtstrahlen und macht, dass sie nicht zum zweiten Mal
zum Grunde des Auges gelangend, die Deutlichkeit der Bilder stören.
Diesen Zweck hat das Pigment an der hintern Fläche der Iris
und des Corpus ciliare. Aber auch die Auskleidung der hintern
Wand der Nervenhaut selbst mit dem Pigment der Choroidea ist
in dieser Hinsicht wichtig. Die Nervenhaut ist sehr durchscheinend,
befände sich hinter ihr eine, das Licht reflectirende, nicht
dunkelgefärbte Haut, so würden die Lichtstrahlen, welche die
Nervenhaut selbst schon getroffen haben, durch die Nervenhaut
wieder zurück reflectirt Averdan, und auf andere Stellen dieser
Membran fallen, Avodurch nicht bloss Blendung durch Uehermass