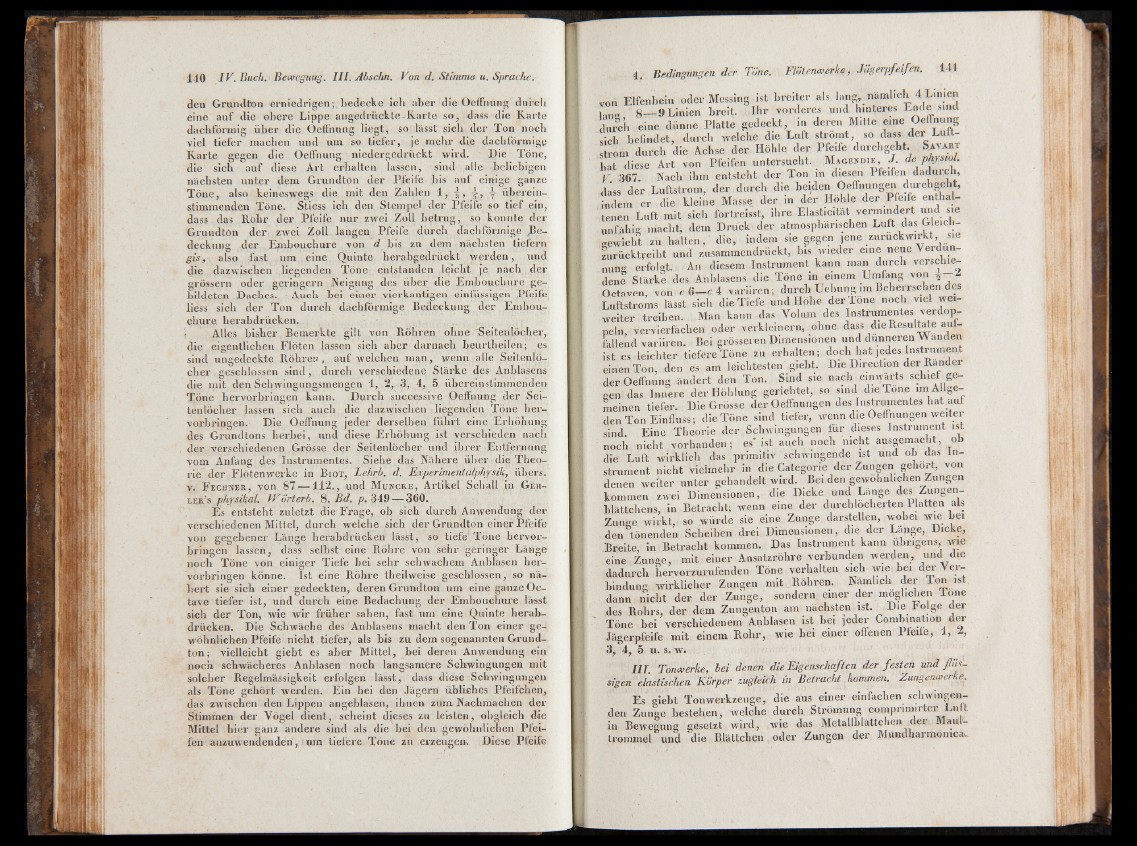
den Grundton erniedrigen; bedecke ich aber die Oeffnung durch
eine auf die obere Lippe angedrückte-Karte so, dass die Karte
dachförmig über die Oeffnung liegt, so lässt sich der Ton noch
viel tiefer machen und um so tiefer, je mehr die dachförmige
Karte gegen die Oeffnung niedergedrückt wird. Die Töne,
die sich auf diese Art erhalten lassen, sind alle beliebigen
nächsten unter dem Grundton der Pfeife bis auf einige ganze
Töne, also keineswegs die mit den Zahlen 1, y, y, y überein-
stimmendqn Töne. Stiess ich den Stempel der Pfeife so tief ein,
dass das Rohr der Pfeife nur zwei Zoll betrug, so konnte der
Grundtön der zwei Zoll langen Pfeife durch dachförmige .„Bedeckung
der Embouchure von d bis zu dem nächsten tiefem
gis, also fast um eine Quinte herabgedrückt werden, und
die dazwischen liegenden Töne entstanden leicht je nach der
grossem oder geringem Neigung des über die Embouchure gebildeten
Daches. Auch bei einer vierkantigen einfüssigen Pfeife
liess sich der Ton durch dachförmige Bedeckung der Embouchure
herabdrücken.
i Alles bisher Bemerkte gilt von Röhren ohne 'Seitenlöcher,
die eigentlichen Flöten lassen sich aber darnach beurtheilen; es
sind ungedeckte. Röhre», auf welchen man, wenn alle Seitenlöcher
geschlossen sind, durch verschiedene Stärke des Anblasens
die mit den Schwingungsmengen 1, 2, 3, 4, 5 übereinstimmenden
Töne hervorbringen kann. Durch successive Oeffnung der Sextenlöcher
lassen sich auch die dazwischen liegenden Töne hervorbringen.
Die Oeffnung jeder derselben führt eine Erhöhung
des Gi und Ions herbei, und diese Erhöhung ist verschieden nach
der verschiedenen Grösse der Seitenlöcher und ihrer Entfernung
vom Anfang des Instrumentes. Siehe ,das Nähere über : die Theorie
der Flötenwerke in B iot, Lehrh. d. Experimentalphysik, übers,
v. F echser, von 87 —112., und Muncke, Artikel Schall in Geh-
ler’s physikdl. Wörter!). 8. Bd. p. 349 — 360.
Es entsteht zuletzt die Frage, ob sich durch Anwendung der
verschiedenen Mittel, durch welche sich der Grundton einer Pfeife
von gegebener Länge herabdrücken lässt, so tiefe’ Töne hervorbringen
lassen, dass selbst eine Röhre von sehr geringer Länge
noch Töne von einiger Tiefe bei sehr schwachem Anblasen hervorbringen
könne. Ist eine Röhre theilweise geschlossen, so nähert
sie sich einer gedeckten, deren Grundton um eine ganze Oc-
tave tiefer ist, und durch eine Bedachung der Embouchure lässt
sich der Ton, wie wir früher sahen, fast um eine Quinte herabdrücken.
Die Schwäche des Anblasens macht den Ton einer gewöhnlichen
Pfeife nicht tiefer, als bis zu dem sogenannten Grundton;
vielleicht giebt es aber Mittel, bei deren Anwendung ein
noch schwächeres Anblasen noch langsamere Schwingungen mit
solcher Regelmässigkeit erfolgen lässt, dass diese Schwingungen
als Töne gehört werden. Ein bei den Jägern übliches Pfeifchen,
das zwischen den Lippen angeblasen, ihnen zum Nachmachen der
Stimmen der Vögel dient, scheint dieses zu leisten, obgleich dJe
Mittel hier ganz andere sind als die bei den gewöhnlichen Pfeifen
allzuwendenden, um tiefere Töne zu erzeugen. Diese Pfeife
von Elfenbein oder Messing ist breiter als lang, nämlich 4 Linien
, 8—9 Linien breit. Ihr vorderes und hinteres Ende sind
durch eine dünne Platte gedeckt, in deren Mitte eine Oeffnung
sich befindet, durch welche die Luft strömt so dass der Luftstrom
durch die Achse der Höhle der Pfeife durchgeht. Savart
bat diese Art von Pfeifen untersucht. Magendie J. dephyswL
V 367 Nach ihm entsteht der Ton in diesen Pfeifen dadurch,
dass der . Luftstrom, der durch die beiden Oeffnungen durchgeht,
indem er die kleine Masse der in der Höhle der Pfeife enthaltenen
Luft mit sich fortreisst, ihre Elasticifät vermindert und sie
unfähie macht, dem Drück der atmosphärischen Luft das Gleich-
„ewicht zu halten,' die, indem sie gegen jene znruckwirkt sie
zurücktreibt und zusammendrückt, bis wieder eine neue Verdünnung
erfolgt. An diesem Instrument kann man durch verschiedene
Stärke des Anblasens die Töne in einem Umfang von y
Octaven von 6 6—c 4 .variiren; durch Uübung ,m Beherrschen des
Luftstroms lässt sich die Tiefe und Höhe der Töne noch viel wei-
weiter treiben. , Man kann das Volum des Instrumentes verdoppeln,
vervierfachen oder verkleinern,-Ohne dass die Resultate auffallend
variiren. Bei grösseren Dimensionen und dünneren Wanden
ist es leichter tiefere Töne zu erhalten; doch hat jedes Instrument
einen Ton, den es am leichtesten giebt. Die Directum derRander
der Oeffnung ändert den Ton. Sind sie nach einwärts scjnef gegen
das Innere der Höhlung gerichtet, so sind die Tone im_ Allgemeinen
tiefer. Die Grösse der Oeffnungen des Instrumentes hat auf
den Ton Einfluss ; die Töne sind tiefer, wenn die Oeffnungen weiter
sind. Eine Theorie der Schwingungen für dieses Instrument ist
noch nicht vorhanden; es* ist auch noch nicht ansgemacht, ob
die Luft wirklich das primitiv schwingende ist und ob das Instrument
nicht vielmehr in die Categorie der Zungen gehört, von
denen weiter unter gehandelt wird. Bei den gewöhnlichen Zungen
kommen zwei Dimensionen, die Dicke und Länge des Zungenblättchens,
in Betracht; wenn eine der durchlöcherten Platten als
Zunge wirkt, so würde sie eine Zunge darsteUen, wobei wie bei
den tönenden Scheiben drei Dimensionen, die der Lange, Dicke,
Breite in Betracht kommen. Das Instrument kann übrigens, wie
eine Zunge, mit einer Ansatzröhre verbunden werden, und die
dadurch hervorzurufenden Töne verhalten sich wie bei der Verbindung
wirklicher Zungen mit Röhren. Nämlich der Ton ist
dann nicht der der Zunge,, sondern einer der möglichen Tone
des Rohrs, der dem .Zungenton am nächsten’-ist. Die Folge der
Töne bei verschiedenem Anblasen ist bei jeder Combination der
Jägerpfeife mit einem Rohr, wie bei einer offenen Pfeife, 1, 1,
3, 4, 5 u. s. w.
I I I Tonwerke, hei denen die Eigenschaften der festen und flüssigen
elastischen Körper zugleich in Betracht kommen. Zungenwerke.
Es giebt Tonwerkzeuge, die aus e in e r einfachen schwingenden
Zunge bestehen, welche durch Strömung conipnmirter Luit
in Bewegung gesetzt wird, wie das Metallblättchen der Mau-
trommel und die B lä ttc h e n . oder Zungen der Mundharmonica.