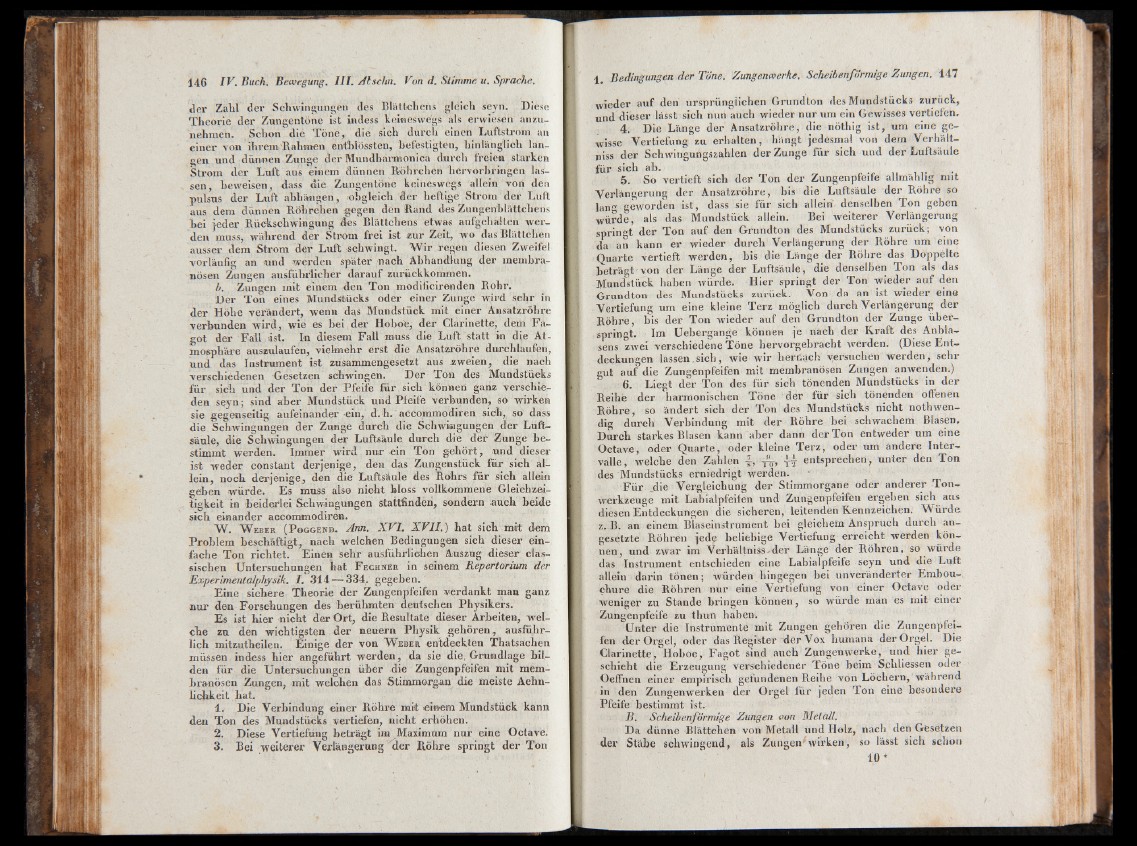
der Zalil der Schwingungen des Blättchens gleich seyn. Dièse
Theorie der Zungentöne ist indess keineswegs als erwiesen anzu-
hehmen. Scho« dié Töne, die sich durch einen Luftstrom an
einer von ihrem 'Rahmen entblössten, befestigten, hinlänglich langen
und dünnen Zunge der Mundharmonica durch freie« starken
Strom der Luft aus einem dünnen Röhrchen hervorbringen lassen,
beweisen, dass die Zungentöne keineswegs allein von den
pulsus der Luft abliängen, obgleich der heftige Strom der Luft
aus dem dünnen Röhrchen gegen den Rand des Zungenblättchens
bei jeder Rückschwingung des Blättchens etwa« aufgehailten werden
muss, während der Strom frei ist zur Zeit, wo das Blättchen
ausser dem Strom der Luft schwingt. Wir regen diesen Zweifel
vorläufig an und werden später nach Abhandlung der membra-
nösen Zungen ausführlicher darauf zurückkommen.
h. Zungen mit einem den Ton modificirenden Rohr.
Der Ton eines Mundstücks oder einer Zünge wird sehr in
der Höhe verändert, wenn das Mundstück mit einer Ansatzröhre
verbunden wird, wie es bei der Hoboe, der Clarinette, dem Fagot
der Fall äst. In diesem Fall muss die Luft statt in die Atmosphäre
auszulaufen, vielmehr erst die Ansatzröhre durchlaufen,
und das Instrument ist zusammengesetzt aus ^zweien, die nach
verschiedenen Gesetzen schwingen. Der Ton des Mundstücks
für sich und der Ton der Pfeife für sich können ganz verschieden
seyn; sind aber Mundstück und Pfeife verbunden, so wirken
sie gegenseitig aufeinander ein, d.-h. accommodiren sich, so dass
die Schwingungen der Zunge durch die Schwingungen der Luftsäule,
die Schwingungen der Luftsäule durch die der Zunge bestimmt
werden. Immer wird nur ein Ton gehört, und dieser
ist weder constant derjenige, den das Zungenstück für sich allein,
noch derjenige, den die Luftsäule des Rohrs für sich allein
geben würde. Es muss also nicht bloss vollkommene Gleichzeitigkeit
in beiderlei Schwingungen stattfinden, sondern auch beide
sich einander accommodiren.
W. W eber ( P oggenb.. Ann. XVI. X V II.) hat sich mit dem
Problem beschäftigt, nach welchen Bedingungen sich dieser einfache
Ton richtet. Einen sehr ausführlichen Auszug dieser clas-
sischen Untersuchungen hat F echner in seinem Repertorium der
Experimentalphysik. I. 314 — 334. gegeben.
Eine sichere Theorie der Zungenpfeifen verdankt mau ganz
nur den Forschungen des berühmten deutschen Physikers.
Es ist hier nicht der Ort, die Resultate dieser Arbeiten, welche
zu den wichtigsten der neuern Physik gehören , ausführlich
mitzutheilen. Einige der von W e b e r entdeckten Thatsachen
müssen indess hier angeführt werden, da sie die, Grundlage bilden
für die Untersuchungen über die Zungenpfeifen mit mem-
branösen Zungen, mit welchen das Stimmorgan die meiste Aehn-
lichkeit hat.
1. Die Verbindung einer Röhre mit einem Mundstück kann
den Ton des Mundstücks vertiefen, nicht erhöhen.
2. Diese Vertiefung beträgt im Maximum nur eine Octave.
3. Bei weiterer Verlängerung der Röhre springt der Ton
wieder auf den ursprünglichen Grundton des Mundstücks zurück,
u nd dieser lässt sich nun auch wieder nur um ein Gewisses vertiefen.
4. Die Länge der Ansatzröhre, die nöthig ist, um eine gewisse
Vertiefung zu erhalten, hängt jedèsma! von dem Verhältnis
der Schwingungszahlen der Zunge für sich und der Luftsäule
für sich ab. ,
5. So vertieft sich der Ton der Zungenpfeife allmählig mit
Verlängerung der Ansatzröhre, bis die Luftsäule der Röhre so
lan" geworden ist, dass sie für sich allein denselben Ton geben
würde; als das Mundstück allein. Bei weiterer Verlängerung
springt der Ton auf den Grundton des Mundstücks zurück; von
da an kann er wieder durch Verlängerung der Röhre um eine
Quarte vertieft werden, bis die Länge der Röhre das Doppelte
beträgt von der Länge der Luftsäule, die denselben Ton als das
Mundstück haben würde. Hier springt der Ton wieder auf den
Grundton des Mundstücks zurück. Von da an ist wieder eins
Vertiefung um eine kleine Terz möglich durch Verlängerung der
Röhre, bis der Ton wieder auf den Grundton der Zunge überspringt.
Im Uebergange können je nach der Kraft des Anblasens
zwei verschiedene Töne hervorgebracht werden. (Diese Entdeckungen
lassen.sich, wie wir herdach versuchen werden, sehr
gut auf die Zungenpfeifen mit membranösen Zungen anwenden.)
6. Liegt der Ton des für sich tönenden Mundstücks in der
Reihe der harmonischen Töne der für sich tönenden offenèn
Röhre, so ändert sich der Ton des Mundstücks nicht nothwen-
dig durch Verbindung mit der Röhre bei schwachem Blasen.
Durch starkes Blasen kann aber dann der Ton entweder um eine
Octave, oder Quarte, oder kleine Terz, oder um andere Intervalle,
welche den Zahlen £, ‘yo, t * entsprechen, unter den Ton
des Mundstücks erniedrigt werden.
Für _die Vergleichung der Stimmorgane oder anderer Tonwerkzeuge
mit Labialpfeifen und Zungenpfeifen ergehen sich aus
diesen Entdeckungen die sicheren, leitenden Kennzeichen, Würde,
z. B. an einem Blaseinstrument hei gleichem Anspruch durch angesetzte
Röhren jede beliebige Vertiefung erreicht werden können,
und zwar im Verhältnisse der Länge der Röhren, so würde
das Instrument entschieden eine Labialpfeife seyn und die Luft
allein darin tönen; würden hingegen bei unveränderter Embouchure
die Röhren nur eine Vertiefung von einer Octave oder
weniger zu Stande bringen können, so würde man es mit einer
Zungenpfeife zu thun haben.
Unter die Instrumente mit Zungen gehören die Zungenpfeifen
der Orgel, oder das Register der Vox humana der Orgel. Die
Clarinette, Hoboe, Fagot sind auch Zungenwerke, und hier geschieht
die Erzeugung verschiedener Töne beim Schliessen oder
Oeffnen einer empirisch gefundenen Reihe von Löchern, während
in den Zungenwerken der Orgel für jeden Ton eine besondere
Pfeife bestimmt ist.
B. Scheibenförmige Zungen von Metall.
Da dünne Blättchen von Metall und Holz, nach den Gesetzen
der Stäbe schwingend, als Zungen^wirken, so lässt sich schon