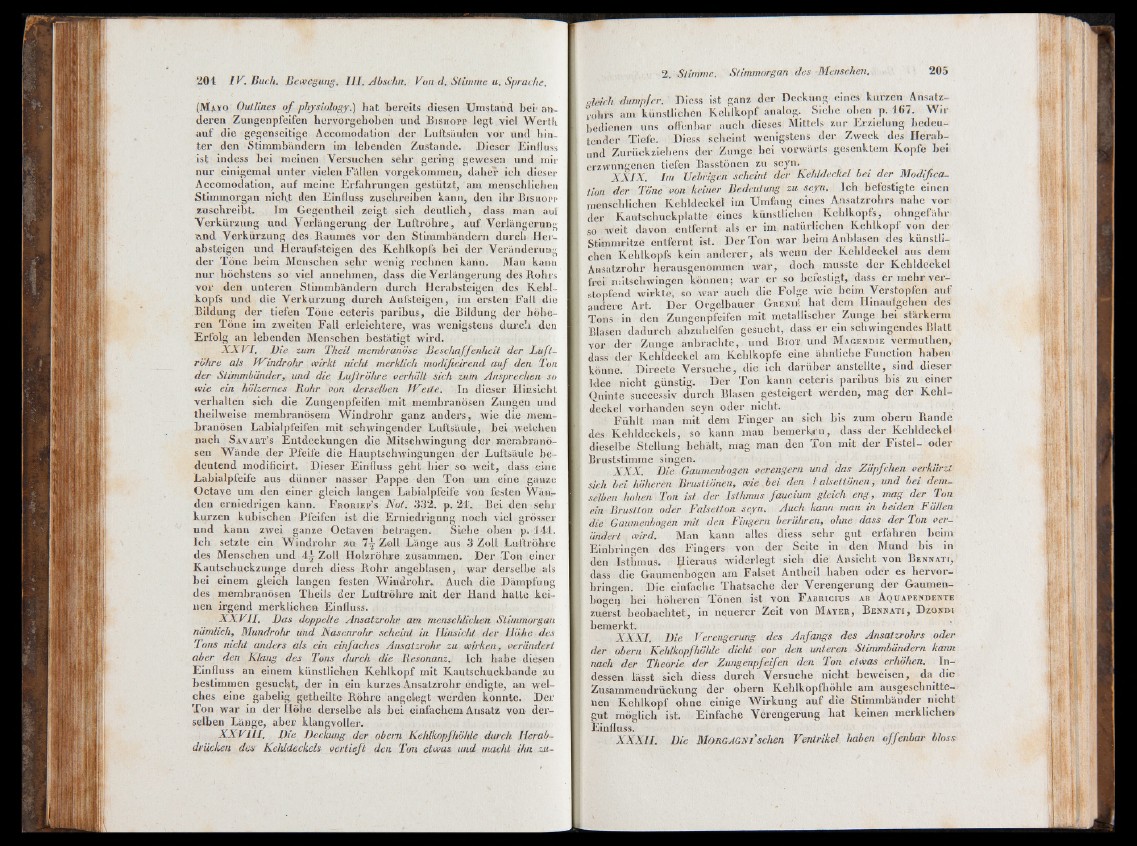
(Mayo Oullines o f physiology.) hat bereits diesen Umstand bei* anderen
Zungenpfeifen hervorgehoben und B ishopp legt viel Werth
auf die gegenseitige Accomodation der Luftsäulen vor und hinter
den Stimmbändern im lebenden Zustande. Dieser Einfluss
ist indess bei meinen Versuchen sehr gering gewesen und mir
nur einigemal unter vielen Fällen vorgekommen, daher ich dieser
Accomodation, auf meine Erfahrungen gestützt, am menschlichen
Stimmorgan nicht den Einfluss zuschreiben kann, den ihr B ishopp
zuschreibt. Im Gegentheil zeigt sich deutlich, dass man auf
Verkürzung und Verlängerung der Luftröhre, auf Verlängerung
und Verkürzung des Raumes vor den Stimmbändern durch Herabsteigen
und Heraufsteigen des Kehlkopfs bei der Veränderung
der Töne beim Menschen sehr wenig rechnen kann. Man kann
nur höchstens so viel annehmen, dass die Verlängerung des Rohrs
vor den unteren Stimmbändern durch Herabsteigen des Kehlkopfs
und die Verkürzung durch Aufsteigen, im ersten-Fall die
Bildung der tiefen Töne ceteris paribus, die Bildung der höheren
Töne im zweiten Fall erleichtere, was wenigstens durch den
Erfolg an lebenden Menschen bestätigt wird.
XXVI. Die. zum Theil membranöse Beschaffenheit der Luftröhre
als Windrohr wirkt nicht merklich modificirend auf den Ton
der- Stimmbänder, und die Luftröhre verhält sich zum Ansprechen so
wie ein hölzernes Rohr von derselben Weite. Id dieser Hinsicht
verhalten sich die Zungenpfeifen mit membranösen Zungen und
tlieilweise membranösem Windrohr ganz anders, wie die membranösen
Labialpfeifen mit schwingender Luftsäule, hei welchen
nach S avart’s Entdeckungen die Mitsehwingung der membranö-
sen Wände der Pfeife die Hauptschwingungen der Luftsäule bedeutend
inodificirt. Dieser Einfluss geht hier so weit, dass eine
Labialpfeife aus dünner nasser Pappe den Ton um eine ganze
Octave um den einer gleich langen Labialpfeife von festen Wänden
erniedrigen kann. F roriep’s Not. .‘132. p. 21.. Bei den sehr
kurzen kubischen Pfeifen ist die Erniedrigung noch viel grösser
und kann zwei ganze Octaven betragen. Siehe oben p. 141.
Ich setzte ein Windrohr zu 7-J- Zoll Länge aus 3 Zoll Luftröhre
des Menschen und 4^ Zoll Holzröhre zusammen. Der Ton einer
Kautschuckzunge durch diess Rohr angeblasen, war derselbe als
bei einem gleich langen festen Windrohr- Auch die Dämpfung
des membranösen Theils der Luftröhre mit der Iiand hatte keinen
irgend merklichen Einfluss.
XX V II. Das doppelte Ansatzrohr am menschlicken Stimmorgan
nämlich, Mundrohr und Nasenrohr scheint in Hinsicht der Höhe des
Tons nicht anders als. ein einfaches Ansatzrohr zu wirken, verändert
aber den Klang des Tons durch die Resonanz.. Ich habe diesen
Einfluss an einem künstlichen Kehlkopf mit Kautsehuckbande zu
bestimmen gesucht, der in ein kurzes.Ansatzrohr endigte, an welches
eine gabelig getheilte Röhre angelegt werden konnte. Der
Ton war in der Höhe derselbe als bei einfachem. Ansatz von derselben
Länge, aber klangvoller.
XXVIII. Die Deckung der obern Kehlkopfhölde durch Herab-
dviiclien des Kehldeckels vertieft den Ton etwas und macht ihn zu2.
Stimme. Stimmorgan des Menschen. 205
gleich dumpfer. Diess ist ganz der Deckung eines kurzen Ansatz-
rohrs am künstlichen Kehlkopf analog. Siehe oben p. 167. Wir
bedienen uns offenbar auch dieses Mittels zur Erzielung bedeutender
Tiefe. Diess scheint wenigstens der Zweck des Herab-
und Zurückziehens der Zunge bei vorwärts gesenktem Kopfe bei
erzwungenen tiefen Basstönen zu seyn.
XXIX. Im Uebrigen scheint der Kehldeckel bei der Modijica-
tion der Töne von keiner Bedeutung zu s e y n Ich befestigte einen
menschlichen Kehldeckel im Umfang eines Ansatzrohrs nahe vor
der Kautschuckplatte eines künstlichen Kehlkopfs, ohngefähr
so weit davon entfernt als er im natürlichen Kehlkopf von der
Stimmritze entfernt ist. Der Ton war beim Anblasen des künstlichen
Kehlkopfs kein anderer, als wenn der Kehldeckel aus dem
Ansatzrohr; herausgenommen war, doch musste der Kehldeckel
frei mitschwingen können; war er so befestigt, dass er mehr verstopfend
wirkte, so war auch die Folge wie beim Verstopfen auf
andere Art. Der Orgelbauer Grenie hat dem Hinaufgehen des
Tons in den Zungenpfeifen mit metallischer Zunge bei stärkerm
Blasen dadurch abzuhelfen gesucht, dass er ein schwingendes Blatt
vor der Zunge anbrachte, und B iot und Magendie vermuthen,
dass der Kehldeckel am Kehlkopfe eine ähnliche Function haben
könne. Directe Versuche, die ich darüber anstellte, sind dieser
Idee nicht günstig. Der Ton kann ceteris paribus bis zu einer
Quinte successiv durch Blasen gesteigert werden, mag der Kehldeckel
vorhanden seyn oder nicht.
Fühlt man mit dem Finger an sich bis zum obern Rande
des Kehldeckels, so kann mau bemerken, dass der Kehldeckel
dieselbe Stellung behält, mag man den Ton mit der Fistel- oder
Bruststimme singen.
XXX. Die Gaumenbogen verengern und das Zäpfchen verkürzt
sich bei höheren Brusttönen, wie bei. den / alsettönen, und bei demselben
hohen Ton ist der Isthmus faucium gleich eng, mag der Ton
ein Brustton oder Falsetton seyn. Auch kann man in beiden Fällen
die Gaumenbogen mit den Fingern berühren, ohne dass der Ton verändert
wird. Man kann alles diess sehr gut erfahren beim
Einbringen des Fingers von der Seite in den Mund bis in
den Isthmus. Hieraus widerlegt sich die Ansicht von B ennati,
dass die Gaumenbogen am Falset Antbeil haben oder es hervor—
bringen. Die einfache Thatsache der Verengerung der Gaumenbogen
bei höheren Tönen ist von F abrigius ab Aquaperuerte
zuerst beobachtet, in neuerer Zeit von Mayer, B erhati, D zohtu
bemerkt.
XXXI. Die Verengerung des Anfangs des Ansatzrohrs oder
der obern 'Kehlkopf höhle dicht vor den unteren Stimmbändern kann
nach der Theorie der Zungenpfeifen den Ton etwas erhöhen. Indessen
lässt sich diess durch Versuche nicht beweisen, da die
Zusammendrückung der obern Kehlkopfhöhle am ausgeschnittenen
Kehlkopf ohne einige Wirkung auf die Stimmbänder nicht
gut möglich ist. Einfache Verengerung bat keinen merklichen
Einfluss.
XXXII. Die M o r g a g n i ’sehen Ventrikel haben o ff mbar bloss