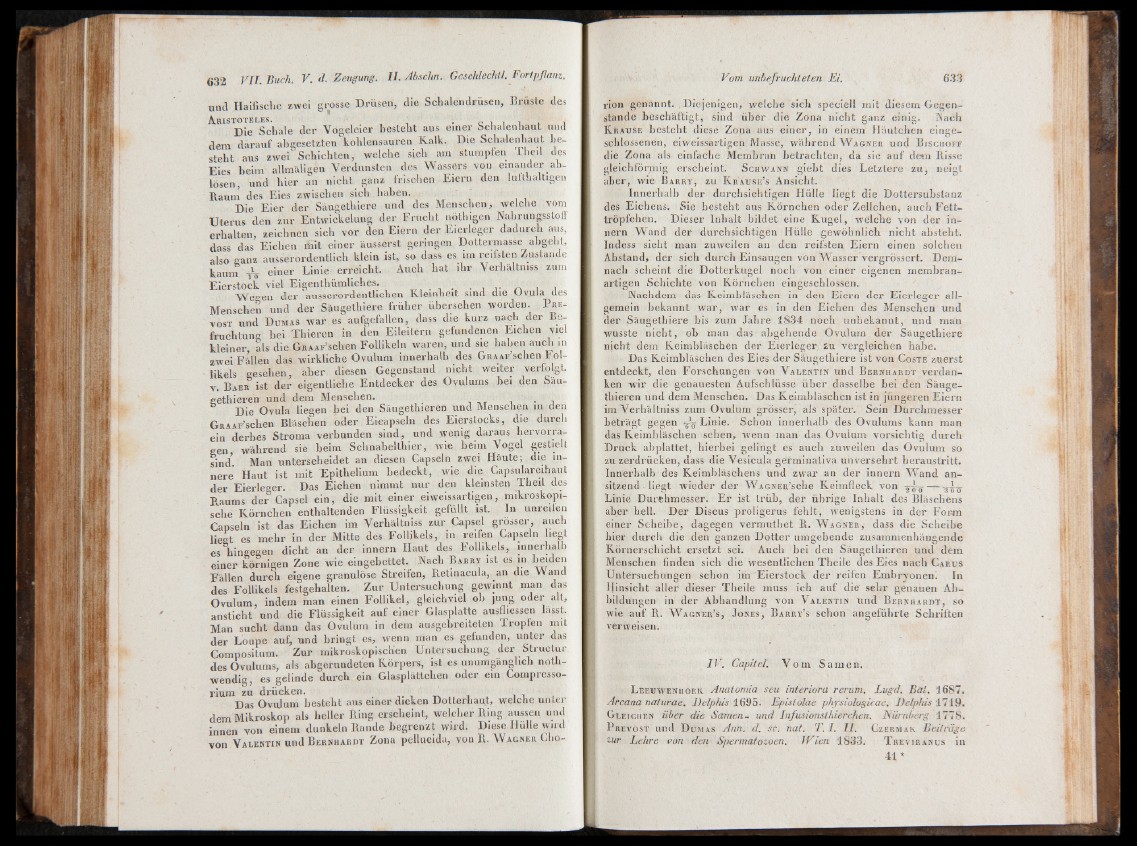
nnd Haifische zwei grosse Drüsen, die Schalendrüsen, Brüste des
Aristoteles. _ .
Die Schale der Vogeleier besteht aus einer Schalenhaut und
dem darauf abgesetzten kohlensauren Kalk. Die Schalenhaut besteht
aus zwei Schichten, welche sich am stumpfen Theil des
Eies beim allmäligen Verdunsten des Wassers von einander ab-
lösen, und hier an nicht ganz frischen Eiern den lult.ialtigen
Raum des Eies zwischen sich haben. IÜ '3
Die Eier der Säugethiere und des Menschen, welche vom
Uterus den zur Entwickelung der Frucht nöthigen Nahrungsstoff
erhalten, zeichnen sich vor den Eiern der Eierleger dadurch aus,
dass das Eichen f i t einer äusserst geringen Dottermasse abgeht,
also ganz ausserordentlich klein ist, so dass es im reifsten Zustande
kaum yV einer Linie erreicht. Auch hat ihr Verhältniss zum
Eierstock viel Eigentümliches. . .
Wegen der ausserordentlichen Kleinheit sind die Uvula des
Menschen und der Säugethiere früher übersehen worden. P re-
vost und D umas war es aufgefallen, dass die kurz nach der Befruchtung
bei Thieren in den Eileitern gefundenen Eichen viel
kleiner, als die GRAAF’schen Follikeln waren, und sie haben auch in
zwei Fällen das wirkliche Ovulum innerhalb des GRAAF’schen Follikels
gesehen, aber diesen Gegenstand nicht weiter verfolgt,
v. Baer ist der eigentliche Entdecker des Ovulums bei den Saug
e tie r e n und dem Menschen. _
Die Ovula liegen }>ei den Säugetieren und Menschen in den
GRAAF’schen Bläschen oder Eieapseln des Eierstocks, die durch
ein derbes Stroma verbunden sind, und wenig daraus hervorragen
während sie beim Schnabeltier, wie beim Vogel gestielt
sind Man unterscheidet an diesen Capsein zwei Haute; die innere
Haut ist mit Epithelium bedeckt, wie die Capsiüareihaut
der Eierleger. Das Eichen nimmt nur den kleinsten Theil des
R.aums der Capsel ein, die mit einer eiweissartigen, mikroskopische
Körnchen enthaltenden Flüssigkeit gefüllt ist. In unreifen
Capsein ist das Eichen im Verhältniss zur Capsel grösser, auch
liegt es mehr in der Mitte des Follikels, in reifen Capsein liegt
es hingegen dicht an der innern Haut des Follikels, innerhalb
einer körnigen Zone wie eingebettet. Nach Barry ist es in beiden
Fällen durch eigene granulöse Streifen, Retinacula, an die Wand
des Follikels festgehalten. Zur Untersuchung gewinnt man das
Ovulum, indem man einen Follikel, gleichviel ob ]ung oder alt,
ansticht und die Flüssigkeit auf einer Glasplatte ausfliessen lasst.
Man sucht dann das Ovulum in dem ausgebreiteten Tropfen mit
der Loupe auf, und bringt es, wenn man es gefunden, unter das
Compositum. Zur mikroskopischen Untersuchung der Structur
des Ovulums, als abgerundeten Körpers, ist es unumgänglich noth-
wendig, es gelinde durch ein Glasplättchen oder ein Compressorium
zu drücken. | , .
Das Ovulum besteht aus einer dicken Dotterhaut, welche unter
dem Mikroskop als heller Ring erscheint, welcher Ring aussen und
innen von einem dunkeln Rande begrenzt wird. Diese Hülle wird
von Valentin und Bernhardt Zona pellucida, von R. W agner Chorion
genannt. Diejenigen, welche sich speciell mit diesem Gegenstände
beschäftigt, sind über die Zona nicht ganz einig. Nach
K rause besteht diese Zona aus einer, in einem Häutchen eingeschlossenen,
eiweiss-artigen Masse, während W agner und Bischoff
die Zona als einfache Membran betrachten, da sie auf dem Risse
gleichförmig erscheint. S chwann giebt dies Letztere zu, neigt
aber, wie Barry, zu K rause’s Ansicht.
Innerhalb der durchsichtigen Hülle liegt die Dottersubslanz
des Eichens. Sie besteht aus Körnchen oder Zellchen, auch Fetttröpfchen.
Dieser Inhalt bildet eine Kugel, welche von der in-
nern Wand der durchsichtigen Hülle gewöhnlich nicht absteht.
Indess sieht man zuweilen an den reifsten Eiern einen solchen
Abstand, der sich durch Einsaugen von Wasser vergrössert. Demnach
scheint die Dotterkugel noch von einer eigenen membranartigen
Schichte von Körnchen eingeschlossen.
Nachdem das Keimbläschen in den Eiern der Eierleger allgemein
bekannt war, war es in den Eichen des Menschen und
der Säugethiere bis zum Jahre 1834 noch unbekannt, und man
wusste nicht, ob man das abgehende Ovulum der Säugethiere
nicht dem Keimbläschen der Eierleger zu vergleichen habe.
Das Keimbläschen des Eies der Säugethiere ist von Coste zuerst
entdeckt, den Forschungen von Valentin und Bernhardt verdanken
wir die genauesten Aufschlüsse über dasselbe bei den Säuge-
tbieren und dem Menschen. Das Keimbläschen ist in jüngeren Eiern
im Verhältniss zum Ovulum grösser, als später. Sein Durchmesser
beträgt gegen ft? Linie. Schon innerhalb des Ovulums kann man
das Keimbläschen sehen, wenn man das Ovulum vorsichtig durch
Druck abplattet, hierbei gelingt es auch zuweilen das Ovulum so
zu zerdrücken, dass die Vesicula germinativa unversehrt heraustritt.
Innerhalb des Keimbläschens und zwar an der innern Wand ansitzend
liegt wieder der W agner’scIic Keimfleck von
Linie Durchmesser. Er ist trüb, der übrige Inhalt des Bläschens
aber hell. Der Discus proligerus fehlt, wenigstens in der Form
einer Scheibe, dagegen vermutliet R. W agner, dass die Scheibe
hier durch die den ganzen Dotter umgebende zusammenhängende
Körnerschicht ersetzt sei. Auch bei den Säugethieren und dem
Menschen finden sich die wesentlichen Theile des Eies nach Carus
Untersuchungen schon im Eierstock der reifen Embryonen. In
Hinsicht aller dieser Theile muss ich auf die sehr genauen Abbildungen
in der Abhandlung von Valentin und B ernhardt, so
wie auf R. W agner’s, J ones, Barry’s schon angeführte Schriften
verweisen.
IV. Capit eh Vom Samen.
L eeuwenhoek Anatomia seu interiora rerurn. Lugd. Bai. 1687.
Arcana naturae. Delphis 1695. Epistolae pbysiologirae. Delphis 1719.
Gleichen über die Sarnen- und Infusionstlderchen. Nürnberg 177S.
P revost und D umas Ann. d. sc. nat. T. I. II. Czermak Beiträge
zur Lehre von den Spermatozoen, JVien 1833. T reviranus in