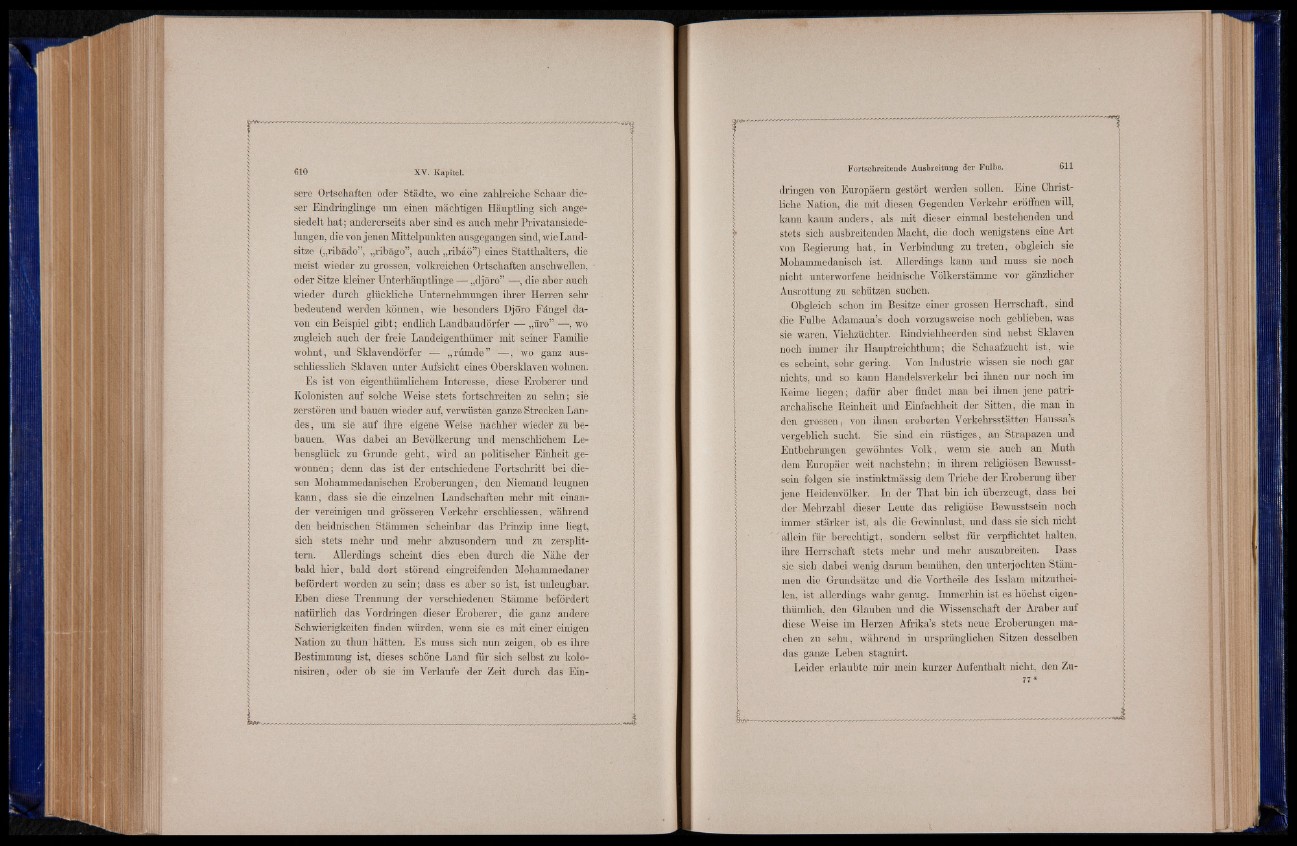
sere Ortschaften oder Städte, wo eine zahlreiche Schaar dieser
Eindringlinge um einen mächtigen Häuptling sich angesiedelt
hat; andererseits aber sind es auch mehr Privatansiedelungen,
die von jenen Mittelpunkten ausgegangen sind, wie Landsitze
(„ribädo”, „ribägo”, auch „ribäö”) eines Statthalters, die
meist wieder zu grossen, volkreichen Ortschaften anschwellen,
oder Sitze kleiner Unterhäuptlinge —- „djöro” —| die aber auch
wieder durch glückliche Unternehmungen ihrer Herren sehr
bedeutend werden können, wie besonders Djöro Fängel davon
ein Beispiel gibt; endlich Landbaudörfer — „üro” —, wo
zugleich auch der freie Landeigentümer mit seiner Pamilie
wohnt, und Sklavendörfer — „rümde” — , wo ganz ausschliesslich
Sklaven unter Aufsicht eines Obersklaven wohnen.
Es ist von eigentümlichem Interesse, diese Eroberer und
Kolonisten auf solche Weise stets fortschreiten zu sehn; sie
zerstören und bauen wieder auf, verwüsten ganze Strecken Landes,
um sie auf ihre eigene Weise nachher wieder zu bebauen.
Was dabei an Bevölkerung und menschlichem Lebensglück
zu Grunde geht, wird an politischer Einheit gewonnen;
denn das ist der entschiedene Fortschritt bei diesen
Mohammedanischen Eroberungen, den Niemand leugnen
kann, dass sie die einzelnen Landschaften mehr mit einander
vereinigen und grösseren Verkehr erschliessen, während
den heidnischen Stämmen Scheinbar das Prinzip inne liegt,
sich stets mehr und mehr abzusondem und zu zersplittern.
Allerdings scheint dies eben durch die Nähe der
bald hier, bald dort störend eingreifenden Mohammedaner
befördert worden zu sein; dass es aber so ist, ist unleugbar.
Eben diese Trennung der verschiedenen Stämme befördert
natürlich das Vordringen dieser Eroberer, die ganz andere
Schwierigkeiten finden würden, wenn sie es mit einer einigen
Nation zu thun hätten. Es muss sich nun zeigen, ob es ihre
Bestimmung ist, dieses schöne Land für sich selbst zu kolo-
nisiren, oder ob sie im Verlaufe der Zeit durch das Eindringen
von Europäern gestört werden sollen. Eine Christliche
Nation, die mit diesen Gegenden Verkehr eröffnen will,
kann kaum anders, als mit dieser einmal bestehenden und
stets sich ausbreitenden Macht, die doch wenigstens eine Art
von Regierung hat, in Verbindung zu treten, obgleich sie
Mohammedanisch ist. Allerdings kann und muss sie noch
nicht unterworfene heidnische Völkerstämme vor gänzlicher
Ausrottung zu schützen suchen.
Obgleich schon im Besitze einer grossen Herrschaft, sind
die Fulbe Adamaua’s doch vorzugsweise noch gebheben, was
sie waren, Viehzüchter. Rindviehheerden sind nebst Sklaven
noch immer ihr Hauptreichthum; die Schaafeucht ist, wie
es scheint, sehr gering. Von Industrie wissen sie noch gar
nichts, und so kann Handelsverkehr bei ihnen nur noch im
Keime liegen; dafür aber findet man bei ihnen jene patriarchalische
Reinheit und Einfachheit der Sitten, die man in
den grossen, von ihnen eroberten Verkehrsstätten Haussa’s
vergeblich sucht. Sie sind ein rüstiges, an Strapazen und
Entbehrungen gewöhntes Volk, wenn sie auch an Muth
dem Europäer weit nachstehn; in ihrem religiösen Bewusstsein
folgen sie instinktmässig dem Triebe der Eroberung über
jene Heidenvölker. In der That bin ich überzeugt, dass bei
der Mehrzahl dieser Leute das religiöse Bewusstsein noch
immer stärker ist, als die Gewinnlust, und dass sie sich nicht
allein für berechtigt, sondern selbst für verpflichtet halten,
ihre Herrschaft stets mehr und mehr auszubreiten. Dass
sie sich dabei wenig darum bemühen, den unterjochten Stämmen
die Grundsätze und die Vortheile des Isslam mitzuthei-
len, ist .allerdings wahr genug. Immerhin ist es höchst eigen-
thümlich, den Glauben und die Wissenschaft der Araber auf
diese Weise im Herzen Afrika’s stets neue Eroberungen machen
zu sehn, während in ursprünglichen Sitzen desselben
das ganze Leben stagnirt.
Leider erlaubte mir mein kurzer Aufenthalt nicht, den Zu