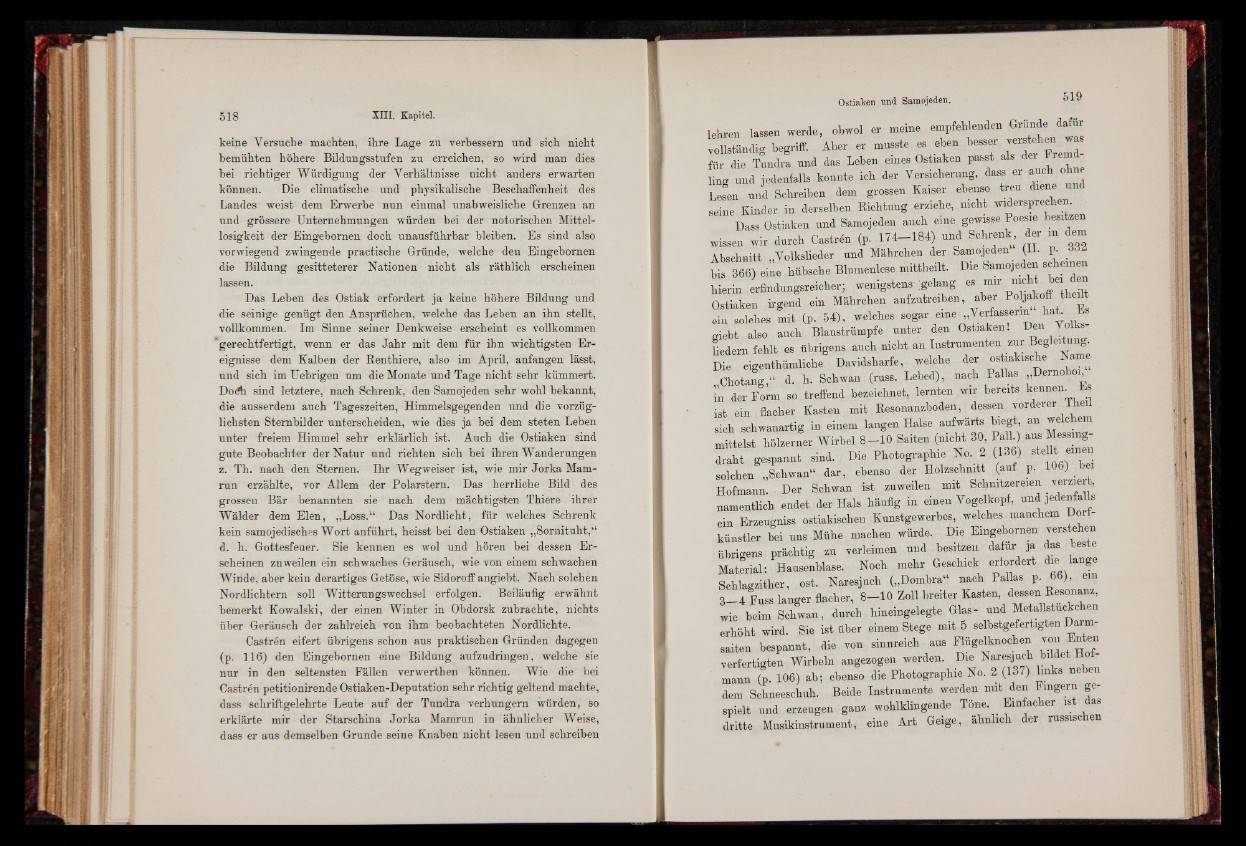
keine Versuche machten, ihre Lage zu verbessern und sich nicht
bemühten höhere Bildungsstufen zu erreichen, so wird man dies
bei richtiger Würdigung der Verhältnisse nicht anders erwarten
können. Die climatische und physikalische Beschaffenheit des
Landes weist dem Erwerbe nun einmal unabweisliche Grenzen an
und grössere Unternehmungen würden bei der notorischen Mittellosigkeit
der Eingebornen doch unausführbar O ' o bleiben. Es sind also
vorwiegend zwingende practische Gründe, welche den Eingebornen
die Bildung gesitteterer Nationen nicht als räthlich erscheinen
lassen. Das Leben des Ostiak erfordert ja keine höhere Bildung und
die seinige genügt den Ansprüchen, welche das Leben an ihn stellt,
vollkommen. Im Sinne seiner Denkweise erscheint es vollkommen
gerechtfertigt, wenn er das Jahr mit dem für ihn wichtigsten Ereignisse
dem Kalben der Renthiere, also im April, anfangen lässt,
und sich im Uebrigen um die Monate und Tage nicht sehr kümmert.
Do(!h sind letztere, nach Schrenk, den Samojeden sehr wohl bekannt,
die ausserdem auch Tageszeiten, Himmelsgegenden und die vorzüglichsten
Sternbilder unterscheiden, wie dies ja bei dem steten Leben
unter freiem Himmel sehr erklärlich ist. Auch die Ostiaken sind
gute Beobachter der Natur und richten sich bei ihren Wanderungen
z. Th. nach den Sternen. Ihr Wegweiser ist, wie mir Jorka Mam-
run erzählte, vor Allem der Polarstern. Das herrliche Bild des
grossen Bär benannten sie nach dem mächtigsten Thiere ihrer
Wälder dem Elen, „Loss.“ Das Nordlicht, für welches Schrenk
kein samojedisches Wort anführt, heisst bei den Ostiaken ,, Somit uht,“
d. h. Gottesfeuer. Sie kennen es wol und hören bei dessen Erscheinen
znweilen ein schwaches Geräusch, wie von einem schwachen
Winde, aber kein derartiges Getöse, wie Sidoroff angiebt. Nach solchen
Nordlichtern soll Witterungswechsel erfolgen. Beiläufig erwähnt
bemerkt Kowalski, der einen Winter in Obdorsk zubrachte, nichts
über Geräusch der zahlreich von ihm beobachteten Nordlichte.
Castren eifert übrigens schon aus praktischen Gründen dagegen
(p. 116) den Eingebornen eine Bildung aufzudringen, welche sie
nur in den seltensten Fällen verwerthen können. Wie die bei
Castren petitionirendeOstiaken-Deputation sehr richtig geltend machte,
dass schriftgelehrte Leute auf der Tundra verhungern würden, so
erklärte mir der Starschina Jorka Mamrun in ähnlicher Weise,
dass er aus demselben Grunde seine Knaben nicht lesen und schreiben
lehren lassen werde, obwol er meine empfehlenden Grunde dafür
vollständig begriff. Aber er musste es eben besser verstehen was
für die Tundra und das Leben eines Ostiaken passt als der Fremd-
Lesen und Schreiben dem grossen Kaiser ebenso treu diene un
seine Kinder in derselben Richtung erziehe, nicht widersprechen.
Dass Ostiaken und Samojeden auch eine gewisse Poesie besitzen
wissen wir durch Castren (p. 174-184) und Schrenk, der in dem
Abschnitt „Volkslieder und Mährchen der Samojeden (II. p. g g
bis 366) ü hübsche Blumenlese mittheilt. Die Samojeden scheinen
hierin erfindungsreicher; wenigstens gelang e s m n nicht bei d
Ostiaken irgend ein Mährchen aufzutreiben aber the^
ein solches mit (p. 54), welches sogar eme J
giebt also auch Blaustrümpfe unter den Ostiaken. Den Volk
liedern fehlt es übrigens auch nicht an Instrumenten zur eg eiging.
Die eigenthümliche Davidsharfe, welche der ostiakische Name
Chotang,“ d. h. Schwan (russ. Lebed), nach Pallas „Dernoboi,
in der Form so treffend bezeichnet, lernten wir bereits kennen. Es
ist ein flacher Kasten mit Resonanzboden, dessen vorderer Theil
sich schwanartig in einem langen Halse aufwärts biegt an welchem
mittelst hölzerner Wirbel 8—10 Saiten (nicht 30, Pall.) aus Messing
draht gespannt sind. Die Photographie No. 2 (136) s te g einen
solchen „Schwan“ dar, ebenso der Holzschnitt (auf p. 106) bei
Hofmann. Der Schwan ist zuweilen mit Schnitzereien verziert
namentlich endet der Hals häufig in einen Vogelkopf, und jedenfalls
ein Erzeugniss ostiakischen Kunstgewerbes, welches manchem Dor
künstler bei uns Mühe machen würde. Die Eingebornen verstehen
übrigens prächtig zu verleimen und besitzen dafür ja das beste
Material: Hausenblase. Noch mehr Geschick erfordert die lange
Schlagzither, ost. Naresjuch („Dombra“ nach Pallas p. ),
3 - 4 Fuss langer flacher, 8 -1 0 Zoll breiter Kasten, dessen Resonanz,
wie beim Schwan, durch hineingelegte Glas- und Metallstuckchen
erhöht wird. Sie ist über einem Stege mit 5 selbstgefertigten Darmsaiten
bespannt, die von sinnreich aus Flügelknochen ™n E n e n
verfertigten Wirbeln angezogen werden. Die Naresjuch bildet Ho
mann (p. 106) ab; ebenso die Photographie No. 2 (137) links neben
dem Schneeschuh. Beide Instrumente werden mit den Fingern gespielt
und erzeugen ganz wohlklingende Töne. Einfacher ist das
dritte Musikinstrument, eine Art Geige, ähnlich er russisc en