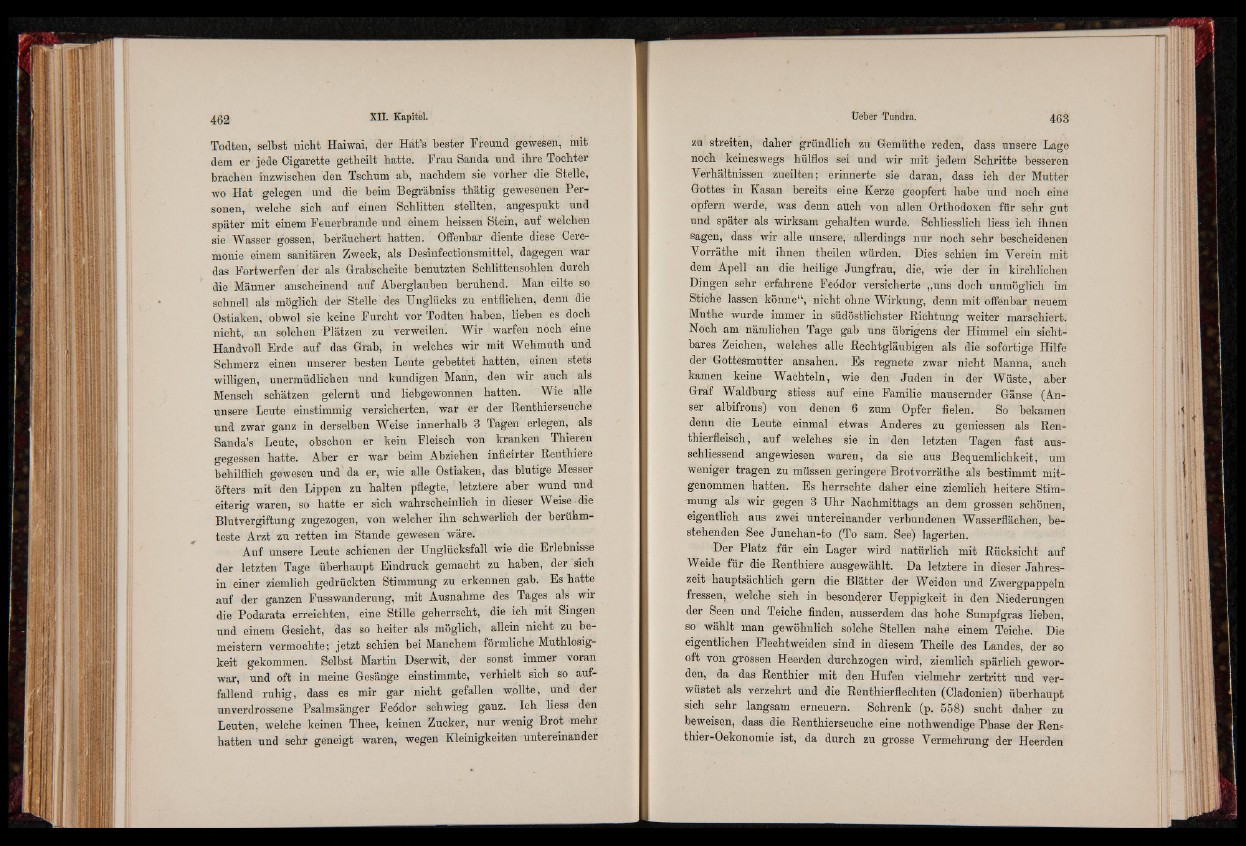
Todten, selbst nicht Haiwai, der Hat’s bester Freund gewesen, mit
dem er jede Cigarette getheilt hatte. Frau Sanda und ihre Tochter
brachen inzwischen den Tschum ab, nachdem sie vorher die Stelle,
wo Hat gelegen und die beim Begräbniss thätig gewesenen Personen,
welche sich auf einen Schlitten stellten, angespukt und
später mit einem Feuer brande und einem heissen Stein, auf welchen
sie Wasser gossen, beräuchert hatten. Offenbar diente diese Cere-
monie einem sanitären Zweck, als Desinfectionsmittel, dagegen war
das Fortwerfen der als Grabscheite benutzten Schlittensohlen durch
die Männer anscheinend auf Aberglauben beruhend. Man eilte so
schnell als möglich der Stelle des Unglücks zu entfliehen, denn die
Ostiaken, obwol sie keine Furcht vor Todten haben, lieben es doch
nicht, an solchen Plätzen zu verweilen. Wir warfen noch eine
Handvoll Erde auf das Grab, in welches wir mit Wehmuth und
Schmerz einen unserer besten Leute gebettet hatten, einen stets
willigen, unermüdlichen und kundigen Mann, den wir auch als
Mensch schätzen gelernt und liebgewonnen hatten. Wie alle
unsere Leute einstimmig versicherten, war er der Renthier seuche
und zwar ganz in derselben Weiso innerhalb 3 Tagen erlegen, als
Sanda’s Leute, obschon er kein Fleisch von kranken Thieren
gegessen hatte. Aber er war beim Abziehen inficirter Renthiere
behilflich gewesen und da er, wie alle Ostiaken, das blutige Messer
öfters mit den Lippen zu halten pflegte, 1 letztere aber wund und
eiterig waren, so hatte er sieh wahrscheinlich in dieser Weise-die
Blutvergiftung zugezogen, von welcher ihn schwerlich der berühmteste
Arzt zu retten im Stande gewesen wäre1;
Auf unsere Leute schienen der Unglücksfall wie die Erlebnisse
der letzten Tage überhaupt Eindruck gemacht zu haben, der sich
in einer ziemlich gedrückten Stimmung zu erkennen gab. Es hatte
auf der ganzen Fusswanderung, mit Ausnahme des Tages als wir
die Podarata erreichten, eine Stille geherrscht, die ich mit Singen
und einem Gesicht, das so heiter als möglich, allein nicht zu be-
meistern vermochte; jetzt schien bei Manchem förmliche Muthlosig-
keit gekommen. Selbst Martin Dserwit, der sonst immer voran
war, und oft in meine Gesänge einstimmte, verhielt sich so auffallend
ruhig, dass es mir gar nicht gefallen wollte, und der
unverdrossene Psalmsänger Feódor schwieg ganz. Ich liess den
Leuten, welche keinen Thee, keinen Zucker, nur wenig Brot mehr
hatten und sehr geneigt waren, wegen Kleinigkeiten untereinander
zu streiten, daher gründlich zu Gemüthe reden, dass unsere Lage
noch keineswegs hülflos sei und wir mit jedem Schritte besseren
Verhältnissen zueilten; erinnerte sie daran, dass ich der Mutter
Gottes in Kasan bereits eine Kerze geopfert habe und noch eine
opfern werde, was denn auch von allen Orthodoxen für sehr gut
und später als wirksam gehalten wurde. Schliesslich liess ich ihnen
sagen, dass wir alle unsere, allerdings nur noch sehr bescheidenen
Yorräthe mit ihnen theilen würden. Dies schien im Verein mit
dem Apell an die heilige Jungfrau, die, wie der in kirchlichen
Dingen sehr erfahrene Feödor versicherte' „uns doch unmöglich im
Stiche lassen könne“, nicht ohne Wirkung, denn mit offenbar neuem
Muthe wurde immer in südöstlichster Richtung weiter marschiert.
Noch am nämlichen Tage gab uns übrigens der Himmel ein sichtbares
Zeichen, welches alle Rechtgläubigen als die sofortige Hilfe
der Gottesmutter ansahen. Es regnete zwar nicht Manna, auch
kamen keine Wachteln, wie den Juden in der Wüste, aber
Graf Waldburg stiess auf eine Familie mausernder Gänse (An-
ser albifrons) von denen 6 zum Opfer fielen. So bekamen
denn die Leute einmal etwas Anderes zu gemessen als Ren-
thierfleisch, auf welches sie in den letzten Tagen fast aus-
schliessend angewiesen waren, da sie aus Bequemlichkeit, um
weniger tragen zu müssen geringere Brotvorräthe als bestimmt mitgenommen
hatten. Es herrschte daher eine ziemlich heitere Stim-
unung als wir gegen 3 Uhr Nachmittags an dem grossen schönen,
eigentlich aus zwei untereinander verbundenen Wasserflächen, bestehenden
See Junehan-to (To sam. See) lagerten.
Der Platz für ein Lager wird natürlich mit Rücksicht auf
Weide für die Renthiere ausgewählt. Da letztere in dieser Jahreszeit
hauptsächlich gern die Blätter der Weiden und Zwergpappeln
fressen, welche sich in besonderer Ueppigkeit in den Niederungen
der Seen und Teiche finden, ausserdem das hohe Sumpfgras liehen,
so wählt man gewöhnlich solche Stellen nahe einem Teiche. Die
eigentlichen Fleehtweiden sind in diesem Theile des Landes, der so
oft von grossen Heerden durchzogen wird, ziemlich spärlich geworden,
da das Renthier mit den Hufen vielmehr zertritt und verwüstet
als verzehrt und die Renthierflechten (Cladonien) überhaupt
sich sehr langsam erneuern. Schrenk (p. 558) sucht daher zu
beweisen, dass die Renthierseuche eine nothwendige Phase der Ren»
thier-Oekonomie ist, da durch zu grosse Vermehrung der Heerden