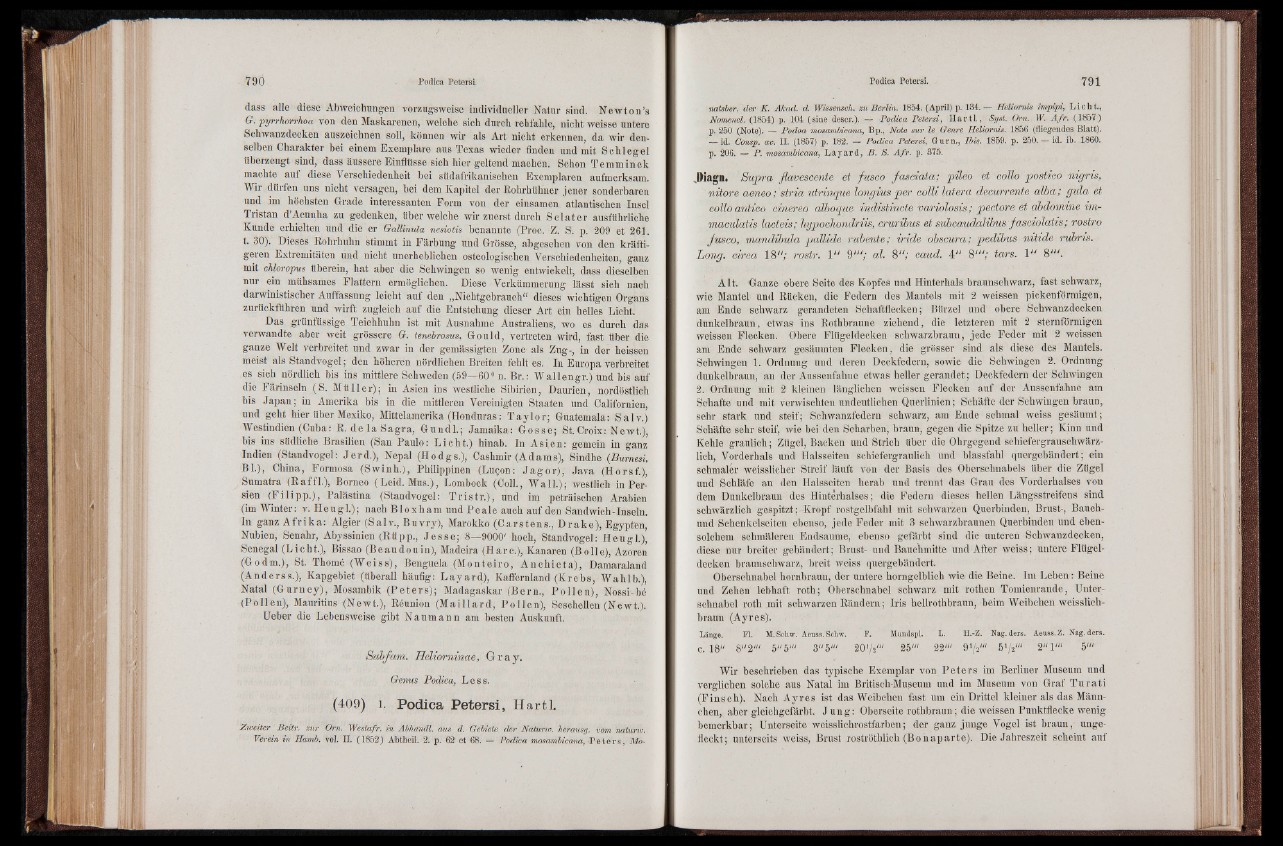
dass alle diese Abweichungen vorzugsweise individueller Natur sind. N ew to n ’s
G. pyrrhorrhoa von den Maskarenen, welche sieh durch rebfahle, nicht weisse untere
&chwanzdecken auszeichnen soll, können wir als Art nicht erkennen, da wir denselben
Charakter bei einem Exemplare aus Texas wieder finden und mit S c h le g e l
überzeugt sind, dass äussere Einflüsse sich hier geltend machen. Schon T emm in ck
machte auf diese Verschiedenheit bei südafrikanischen Exemplaren aufmerksam.
Wir dürfen uns nicht versagen, bei dem Kapitel der Rohrhüh'ner jener sonderbaren
und im höchsten Grade interessanten Form von der einsamen atlantischen Insel
Tristan d’Acunha zu gedenken, über welche wir zuerst durch S c la te r ausführliche
Kunde erhielten und die er Gallinula nesiotis benannte (Proc. Z. S. p. 209 et 261.
t. 30). Dieses Rohrhuhn stimmt in Färbung und Grösse, abgesehen von den kräftigeren
Extremitäten und nicht unerheblichen osteologischen Verschiedenheiten, ganz
mit chloropus überein, hat aber die Schwingen so wenig entwickelt, dass dieselben
nur ein mühsames Flattern ermöglichen. Diese Verkümmerung lässt sich nach
darwinistischer Auffassung leicht auf den „Nichtgebrauch“ dieses wichtigen Organs
zurückführen und wirft zugleich auf die Entstehung dieser Art ein helles Licht.
Das grünfüssige Teichhuhn ist mit Ausnahme Australiens, wo es durch das
verwandte aber weit grössere G. tenebrosus, Go u ld , vertreten wird, fast über die
ganze Welt verbreitet und zwar in der gemässigten Zone' als Züg-, in der heissen
meist als Standvogel ; den höheren nördlichen Breiten fehlt es. In Europa verbreitet
es sich nördlich bis ins mittlere Schweden (59—60° n. Br.: W a llen g r.) und bis auf
die Färinseln (S. M ü lle r ) ; in Asien ins westliche Sibirien, Daurien, nordöstlich
bis Japan; in Amerika bis in die mittleren Vereinigten Staaten und Californien,
und geht hier über Mexiko, Mittelamerika (Honduras: T a y lo r ; Guatemala: S a lv .)
Westindien (Cuba: R. d e l a S a g r a , G u n d l.; Jamaika: G o s s e ; St. Croix: Newt.),
bis ins südliche Brasilien (San Paulo: L ic h t.) hinab. In A sie n : gemein in ganz
Indien (Standvogel: J e rd .), Nepal (Hodgs.), Cashmir (Adams), Sindhe (Burnesi,
Bl.), China, Formosa (Sw in h .), Philippinen (Luçon: J a g o r ) , Java (Ho rsf.),
Sumatra (R a ffl.), Borneo (Leid. Mus.), Lombock (Coll., W a ll.); westlich in Persien
(F ilip p .) , Palästina (Standvogel: T r is tr .) , und im peträischen Arabien
(im Winter: v. H eu g l.); nach B lo x h am und P e a le auch auf den Sandwich-Inseln.
In ganz A f r ik a : Algier (Salv., Buvry), Marokko (C a rs te n s ., D r a k e ), Egypten,
Nubien, Senahr, Abyssinien (Rüpp., J e s s e ; 8—9000' hoch, Standvogel: H eu g l.),
Senegal (L ich t.), Bissao (B e au d o u in ), Madeira (H a rc.),,Kanaren (Bolle), Azoren
(Godm.), St. Thomé (W e is s ), Benguela (Monteil-o , A n c h ie ta ) , Damaraland
(A n d e rss .), Kapgebiet (überall häufig: L a y a rd ) , Kaffernland (K reb s, Wahlb.),
Natal (G u rn e y ), Mosambik (P e te r s ) ; Madagaskar (Bern., P o lle n ) , Nossi-bé
(P o llen ), Mauritius (Newt.), Réunion (M a illa rd , P o lle n ) , Seschellen (N ew t.).
Ueber die Lebensweise gibt N a um a n n am besten Auskunft.
Subfam. Heliorninae, Gray.
Genus Podica, Less.
(409) l. Podica Petersi, Hartl.
Zweiter Beitr. zur Orn. Westafr. in Äbhandl. aus d. Gebiete der Naturw. herausg. vom naturw.
Verein in Hamb. vol. II. (1852) Abtheil. 2. p. 62 et 68. — Podica mosambicma, P e t e r s , Monatsber.
der K. AJcad. d. Wissensch. zu Berlin. 1854. (April) p. 134.— Heliornis impipi, L ic h t.,
Nomencl. (1854) p. 104 (sine descr.). — Podica Petersi, H a r tl., Syst. Orn. W. A fr . (1857)
p. 250 (Note). —■ Podoa mosambiccma, Bp., Note sur le Gerne Heliornis. 1856 (fliegendes Blatt).
— id. Consp. av. II. (1857) p. 182. — Podica Petersi, G u r n., Ibis. 1859. p. 250. — id. ib. 1860.
p. 206. — P. mosambicana, L a y a rd , B. S. A fr. p. 375.
.Diagn. Supra flavescente et fusco fasdata; pileo et collo postico nigris,
nitore aeneo; stria utrinque longius per colli latera decurrente alba; gula et
collo antico einereo alboque indistincte Uariolosis; pectore et abdomine im-
maculatis lacteis; Jiypochondrüs, crUribus et subcaudalibus fasciolatis; rostro
fusco, mandibula pallide rubente; iride obscura; pedibus nitide rubris.
Long. circa 18"; rostr. 1" 9'"; al. 8"; caud. 4" 8'"; tairs. 1" 8'".
Alt. Ganze obere Seite des Kopfes und Hinterhals braunschwarz, fast schwarz,
wie Mantel und Rücken, die Federn des Mantels mit 2 weissen pickenförmigen,
am Ende schwarz gerandeten Schaftflecken; Bürzel und obere Schwanzdeeken
dunkelbraun, etwas ins Rothbraune ziehend, die letzteren mit 2 sternförmigen
weissen Flecken. Obere Flügeldecken schwarzbraun, jede Feder mit 2 weissen
am Ende schwarz gesäumten Flecken, die grösser sind als diese des Mantels.
Schwingen 1. Ordnung und deren Deckfedern, sowie die Schwingen 2. Ordnung
dunkelbraun, an der Aussenfahne etwas heller gerandet; DeckfedernderSchwingen
2. Ordnung mit 2 kleinen länglichen weissen Flecken auf der Aussenfahne am
Schafte und mit verwischten undeutlichen Querlinien; Schäfte der Schwingen braun,
sehr stark und steif; Schwanzfedern schwarz, am Ende schmal weiss gesäumt;
Schäfte sehr steif, wie bei den Scharben, braun, gegen die Spitze zu heller; Kinn und
Kehle graulich; Zügel, Backen und Strich über die Ohrgegend schiefergrauschwärzlich,
Vorderhals und Halsseiten schiefergraulich und blassfahl quergebändert; ein
schmaler weisslicher Streif läuft von der Basis des Oberschnabels über die Zügel
und Schläfe an den Halsseiten herab und trennt das Grau des Vorderhalses von
dem Dunkelbraun des Hinterhalses; die Federn dieses hellen Längsstreifens sind
schwärzlich gespitzt; Kropf rostgelbfahl mit schwarzen Querbinden, Brust-, Bauch-
und Schenkelseiten ebenso, jede Feder mit 3 schwarzbraunen Querbinden und ebensolchem
schmäleren Endsaume, ebenso gefärbt sind die unteren Schwanzdecken,
diese nur breiter gebändert; Brust- und Bauchmitte und After weiss; untere Flügeldecken
braunschwarz, breit weiss quergebändert.
Oberschnabel hornbraun, der untere horngelblich wie die Beine. Im Leben: Beine
und Zehen lebhaft roth; Oberschnabel schwarz mit rothen Tomienrande, Unterschnabel
roth mit schwarzen Rändern; Iris hellrothbraun, beim Weibchen weisslich-
braun (Ayres). .
Länge. PL M.Sohw. Aenss.Schw. . P . Mundspl.. L. H.-Z. Nag.ders. Aeuss.Z. Nag. dere.
c. 18“ 8" 2'" 5" 5"' 3“ 5'“ 20'/i‘“ 25'" 22"' 9V2'" ö’/i'" 2"1'" 5'"
Wir beschrieben das typische Exemplar von P e te r s im Berliner Museum und
verglichen solche aus Natal im Britisch-Museum und im Museum von Graf T u r a ti
(Finsch). Nach A y re s ist das Weibchen fast um ein Drittel kleiner als das Männchen,
aber gleichgefärbt. J u n g : Oberseite rothbraun; die weissen Punktflecke wenig
bemerkbar; Unterseite weisslichrostfarben; der ganz junge Vogel ist braun, ungefleckt;
unterseits weiss, Brust roströthlich (B o n ap a rte ). Die Jahreszeit scheint auf