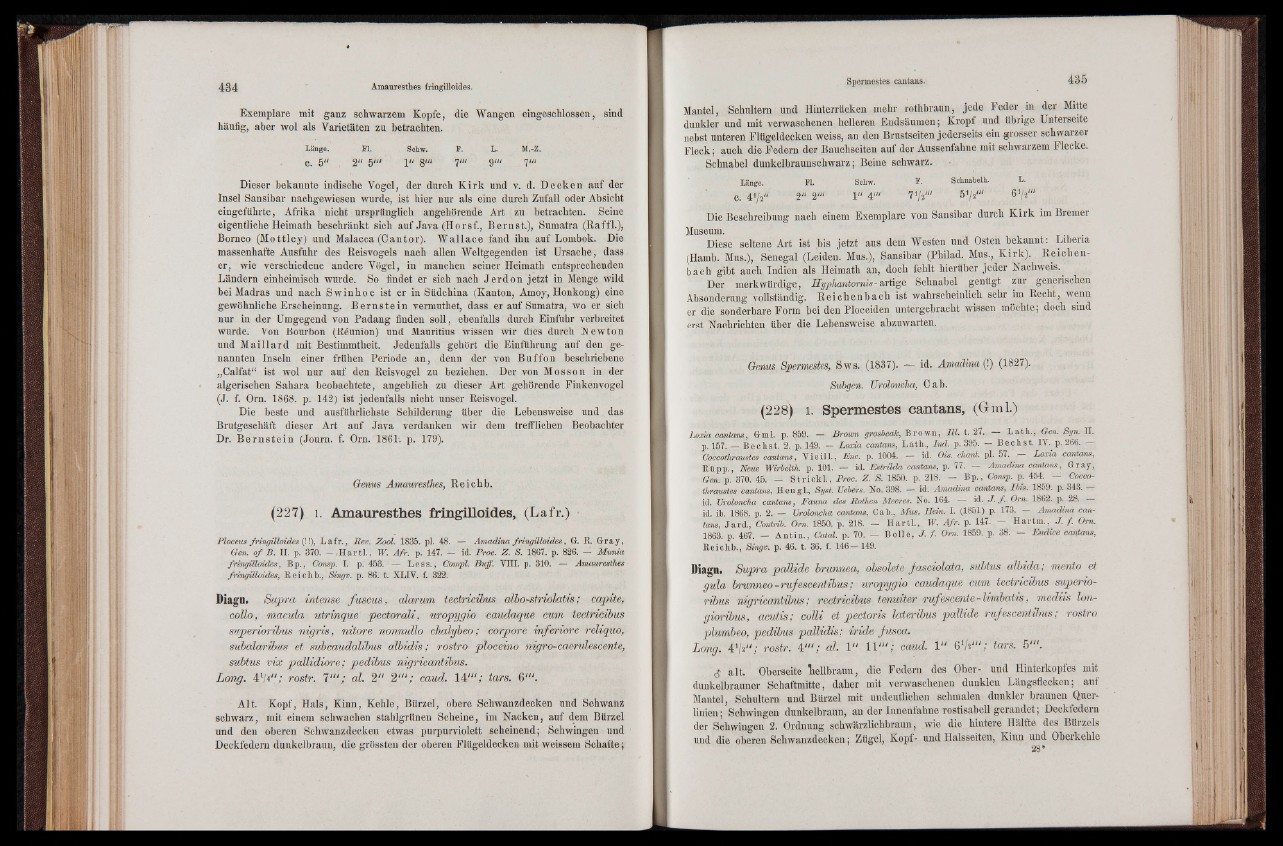
Exemplare mit ganz schwarzem Kopfe, die Wangen eingeschlossen, sind
häufig, aber wol als Varietäten zu betrachten.
Länge. Fl. Schw. F. L. M.-Z.
c. 5" , 2" 5'" 1" 8"' 7"' 9"' 7"'
Dieser bekannte indische Vogel, der durch K irk und v. d. D e c k e n auf der
Insel Sansibar nachgewiesen wurde, ist hier nur als eine durch Zufall oder Absicht
eingeführte, Afrika nicht ursprünglich angehörende Art zu betrachten. Seine
eigentliche Heimath beschränkt sich auf Java (Hörsf., Bernst.), Sumatra (Raffl.),
Borneo (Mottley) und Malacca (Cantor). W a lla e e fand ihn auf Lombok. Die
massenhafte Ausfuhr des Beisvogels nach allen Weltgegenden ist Ursache, dass
er, wie verschiedene andere Vögel, in manchen seiner Heimath entsprechenden
Ländern einheimisch wurde. So findet er sich nach J e rd o n jetzt in Menge wild
bei Madras und nach Sw in h o e ist er in Südchina (Kanton, Amoy, Honkong) eine
gewöhnliche Erscheinung. B e rn s te in vermuthet, dass er auf Sumatra, wo er sich
nur in der Umgegend von Padang finden soll, ebenfalls durch Einfuhr verbreitet
wurde. Von Bourbon (Réunion) und Mauritius wissen wir dies durch Newto n
und M a illa rd mit Bestimmtheit. Jedenfalls gehört die Einführung auf den genannten
Inseln einer frühen Periode an , denn der von B u ffo n beschriebene
„Calfat“ ist wol nur auf den Reisvogel zu beziehen. Der von Mosson in der
algerischen Sahara beobachtete, angeblich zu dieser Art gehörende Finkenvogel
(J. f. Om. 1868. p. 142) ist jedenfalls nicht unser Reisvogel.
Die beste und ausführlichste Schilderung über die Lebensweise und das
Brutgesehäft dieser Art auf Java verdanken wir dem trefflichen Beobachter
Dr. B e rn s te in (Joum. f. Orn. 1861-. p. 179).
Genus Amauresthes, Reieh b .
(227) gj Amauresthes fringilloides, (Lafr.)
Ploceus fringilloides (!!), L a fr ., Rev. Zool. 1835. pl. 48. — Arnadina fringilloides, G. R. G ray ,
Gen. o f B. II. p. 370. —,H a r tl., W. Afr. p. 147. — id. Proc. Z. S. 1867. p. 826. — Mvma
fringilloides, Bp., Consp. I. p. 453. — L e s s ., Compl. Buff. VIII. p. 310. — Amauresthes
fringilloides, R e ie h b ., Smgv. p. 86. t. XLIV. f. 322.
Diagn. Supra interne fuseus, alarum tectricibus albo-striolatis; capite,
collo, macula utrinque peetorali, uropygio caudaque cum tectricibus
superioribus nigris, nitore nonnullo chalybeo; corpore inferiore reliquo,
subalaribus et subcaudalibus albidis; rostro ploceino nigro-caerulescente,
subtus vix pallidiore; pedibus nigricantibus.
Long. 4 1/*"; rostr. 7 '" ; ul. 2" 2 " '; caud. 14'"/ tars. 6"'.
Alt. Kopf, Hals, Kinn, Kehle, Bürzel, obere Schwanzdecken und Schwanz
schwarz, mit einem schwachen stahlgrünen Scheine, im Nacken, auf dem Bürzel
und den oberen Schwanzdecken etwas purpurviolett scheinend; Schwingen und
Deckfedern dunkelbraun, die grössten der oberen Flügeldecken mit weissem Schafte;
Mantel, Schultern und Hinterrücken mehr rothbraun, jede Feder in der Mitte
dunkler und mit verwaschenen helleren Endsäumen; Kropf und übrige Unterseite
nebst unteren Flügeldecken weiss, an den Brustseiten jederseits ein grösser schwarzer
Fleck; auch die Federn der Bauchseiten auf der Aussenfahne mit schwarzem Flecke.
Schnabel dunkelbraunschwarz; Beine schwarz.
Länge. FL Schw. F. Schnibelh. L.
C. 4 ll l ‘r 2" 2;" 1" 4'" I W ß '/i" '
Die Beschreibung nach einem Exemplare von Sansibar durch K irk im Bremer
Museum.
Diese seltene Art ist bis jetzt aus dem Westen und Osten bekannt: Liberia
(Hamb. Mus.), Senegal (Leiden. Mus.), Sansibar (Philad. Mus., Kirk). R e ic h e n bach
gibt auch Indien als Heimath an, doch fehlt hierüber jeder Nachweis.^
Der merkwürdige, Hyphantornis - artige Schnabel genügt zur generischen
Absonderung vollständig. R e ic h e n b a c h ist wahrscheinlich sehr im Recht, wenn
er die sonderbare Form bei den Ploceiden untergebracht wissen möchte; doch sind
erst Nachrichten über die Lebensweise abzuwarten.
Genus Spermestes, Sws. (1837). — id. Arnadina (J) (1827).
Subgen. Uröloncha, Cab.
(228) i. Spermestes cantans, (Gml.)
Loxia cantans, Gml. p. 859. — Brown grosbeale, B row n , lll. t. 27. L a th ., Gen. Syn. Ü.
p. 157. — B e c h s t. 2. p. 149. — Loxia cantans, Lath., Ind. p. 395. —: B e c h s t. IV. p. 266. —.
Coccothramstes cantans, V ie ill., Enc. p.' 1004. — id. Ois. chant. pl. 57. Loxia cantans,
Rüppi, Neue Wirbetth. p. 101. — id. EstriUa cantans, p. 77. — Arnadina cantans, Gray ,
Gm. p. 370. 45. — S t r i c k t , Proc. Z. S. 1850. p. 218. - Bp., Consp. p. 454. W'Cocco-
thraustes cantans, Heugl-, Syst. Uebers. No. 398. — id. Arnadina cantans, Ibis. 1859. p. 343.
id. Uroloncha cantans, Fauna des Rothen Meeres. No. 164. — id. J. f . Orn. 1862. p. 28. —
id. ib. 1868. p. 2. — Uroloncha, cantans, Cab., Mus. Hein. I. (1851) p. 17.3. Arnadina canta
n s,! s t A., Cordrib. Orn. 1850. p. 218. —' H a r tl., W. Afr. p. 147. — H a rtm ., ./. f. Om.
1863. p. 467. — A n tin ., Catal. p. 70. — B o lle , J. f. Om. 1859. p. 38. — Eudice cantans,
R e ichb., Singv. p. 46. t. 36. f. 146 —149.
Diagn, Supra pallide brunnea, obsolete fasciolata, subtus albida; mento et
gula brunneo-rufescentibus/ uropygio caudaque cum tectricibus superioribus
nigricantibus; rectricibus tenuiter rufescente-limbatis, mediis lon-
gioribus, acutis; colli et pectoris lateribus pallide rufescentibus; rostro
plumbeo, pedibus paUidis; iride fusca.
Long. 4 lh " ; rostr. 4 '" ; al. 1" I V " / caud. 1" 6f# " | tars. 5'".
S a lt. Oberseite hellbraun, die Federn des Ober- und Hinterkopfes mit
dunkelbrauner Schaftmitte, daher mit verwaschenen dunklen Längsflecken; auf
Mantel, Schultern und Bürzel mit undeutlichen schmalen dunkler braunen Querlinien;
Schwingen dunkelbraun, an der Innenfahne rostisabell gerundet; Deckfedem
der Schwingen 2. Ordnung schwärzlichbraun, wie die hintere Hälfte des Bürzels
und die oberen Schwanzdecken; Zügel, Kopf- und Hälsseiten, Kinn und Oberkehle