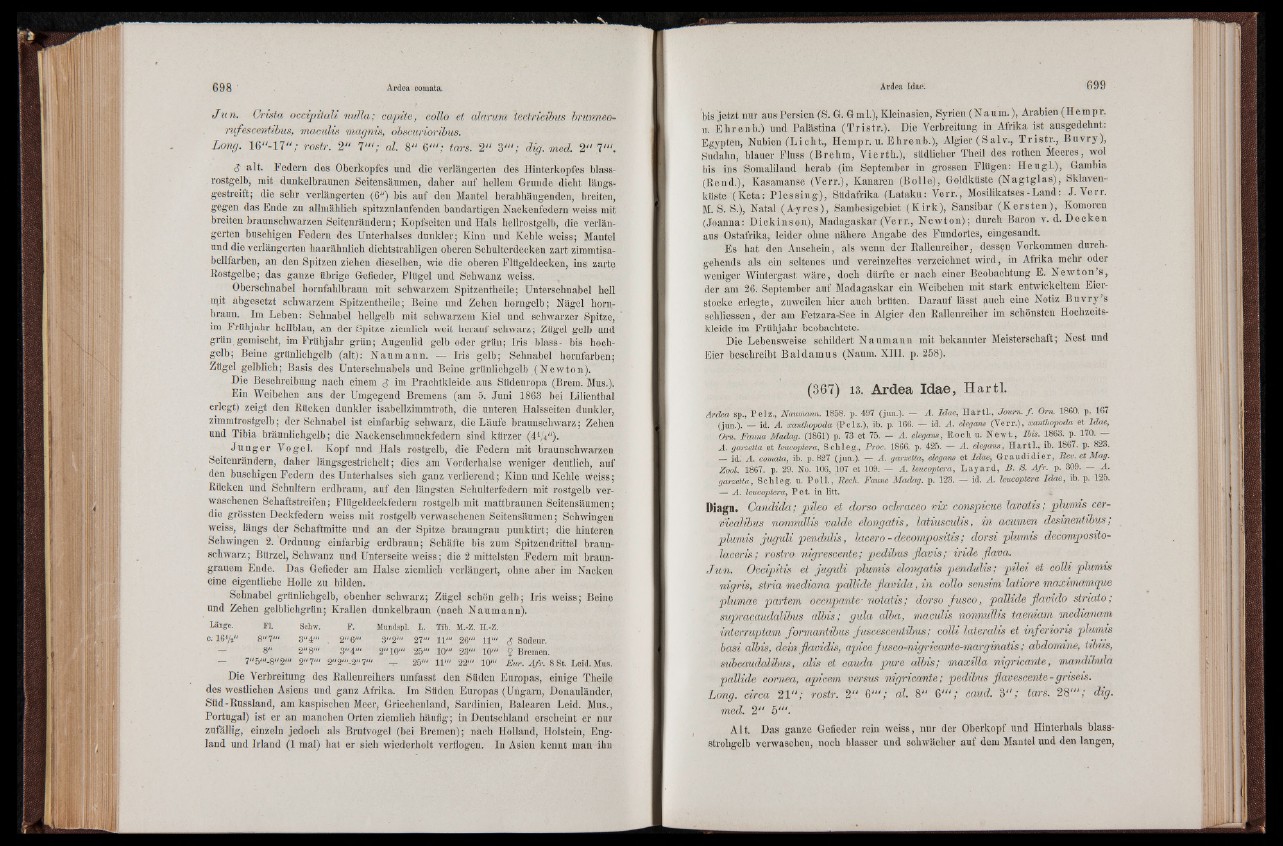
J u n . Orista occipitali nulla; capite, collo et (darum tectricibus brnnneo-
rufescmtibus, maculis magnis, obscurioribus.
Lang. 16"-17"; rostr. 2" 7'"; al. 8" 6'"; tars. 2" 3"'; dig.med. 2“ 7'".
$ alt. Federn des Oberkopfes und die verlängerten des Hinterkopfes blassrostgelb,
mit dunkelbraunen Seitensäumen, daher auf hellem Grunde dicht längsgestreift;
die sehr verlängerten (6") bis auf den Mantel herabhängenden, breiten,
gegen das Ende zu allmählich spitzzulaufenden bandartigen Naekenfedern weiss mit
breiten braunschwarzen Seitenrändern; Kopfseiten und Hals hellrostgelb, die verlängerten
buschigen Federn des Unterhalses dunkler; Kinn und Kehle weiss; Mantel
und die verlängerten haarähnlioh dichtstrahligen oberen Schulterdecken zart zimmtisa-
bellfarben, an den Spitzen ziehen dieselben, wie die oberen Flügeldecken, ins zarte
Rostgelbe; das ganze übrige Gefieder, Flügel und Schwanz weiss.
Oberschnabel hornfahlbraun mit schwarzem Spitzentheile; Unterschnabel hell
mit abgesetzt schwarzem Spitzentheile; Beine und Zehen horngelb; Nägel hornbraun.
Im Leben: Schnabel hellgelb mit schwarzem Kiel und schwarzer Spitze,
im Frühjahr hellblau, an der Spitze ziemlich weit herauf schwarz; Zügel gelb und
grün gemischt, im Frühjahr grün; Augenlid gelb oder grün; Iris blass- bis hochgelb;
Beine grünlichgelb (alt): N a um a n n . Iris gelb; Schnabel hornfarben;
Zügel gelblich; Basis des Unterschnabels und Beine grünlichgelb (N ew to n ).
Die Beschreibung nach einem $ im Prachtkleide aus Südeuropa (Brem. Mus.).
Ein Weibchen aus der Umgegend Bremens (am 5. Juni 1863 bei Lilienthal
erlegt) zeigt den Bücken dunkler isabellzimmtroth, die unteren Halsseiten dunkler,
zimmtrostgelb; der Schnabel ist einfarbig schwarz, die Läufe braunschwarz; Zehen
und Tibia bräunlichgelb; die Nackenschmuckfedern sind kürzer (D/i").
J u n g e r Vogel. Kopf und Hals rostgelb, die Federn mit braunschwarzen
Seitenrändern, daher längsgestrichelt; dies am Vorderhalse weniger deutlich, auf
den buschigen Federn des Unterhalses sich ganz verlierend; Kinn und Kehle weiss;
Rücken und Schultern erdbraun, auf den längsten Schulterfedern mit rostgelb verwaschenen
Schaftstreifen; Flügeldeckfedern rostgelb mit mattbraunen Seitensäumen;
die grössten Deckfedern weiss mit rostgelb verwaschenen Seitensäumen; Schwingen
weiss, längs der Schaftmitte und an der Spitze braungrau punktirt; die hinteren
Schwingen 2. Ordnung einfarbig erdbraun; Schäfte bis zum Spitzendrittel braunschwarz
; Bürzel, Schwanz und Unterseite weiss; die 2 mittelsten Federn mit braungrauem
Ende. Das Gefieder am Halse ziemlich verlängert, ohne aber im Nacken
eine eigentliche Holle zu bilden.
Schnabel grünlichgelb, obenher schwarz; Zügel schön gelb; Iris weiss; Beine
und Zehen gelblichgrün; Krallen dunkelbraun (nach Naumann).
Länge. Fl. Schw. F. Mimdspl. L. Tib. M.-Z. H.-Z.
c. 1 6 V 8" 7'" 3 " i‘" . 2"6"' 3"2'" 27"' 11‘" 26'" 11'" <J Südeur.
— 8" 2" 8'" 3" 4'" 2" 10‘" 25'" 10'" 23'" 10‘" .$ Bremen.
— 7"5'"-8"2‘" 2" 7'" 2"2'"-2"7'" 25"' 11‘" 22'" 10‘" Ewr. Afr. 8 St. Leid. Mus.
Die Verbreitung des Ballenreihers umfasst den Süden Europas, einige Theile
des westlichen Asiens und ganz Afrika. Im Süden Europas (Ungarn, Donauländer,
Süd-Bussland, am kaspischen Meer, Griechenland, Sardinien, Balearen Leid. Mus.,
Portugal) ist er an manchen Orten ziemlich häufig; in Deutschland erscheint er nur
zufällig, einzeln jedoch als Brutvogel (bei Bremen); nach Holland, Holstein, England
und Irland (1 mal) hat er sieh wiederholt verflogen. In Asien kennt man ihn
bis jetzt nur aus Persien (S. G. Gml.), Kleinasien, Syrien (N aum .), Arabien (Hempr.
u. E h re n b .) und Palästina (T ris tr .). Die Verbreitung in Afrika ist ausgedehnt:
Egypten, Nubien (L ic h t., Hempr. u. E h ren b .), Algier (S a lv ., T r is tr ., B u v ry ),
Sudahn, blauer Fluss (B rehm , V ie rth .), südlicher Theil des rothen Meeres, wol
bis ins Somaliland herab (im September in grossen Flügen: Heu g l.), Gambia
(Bend.), Kasamanse (Verr.), Kanaren (Bolle), Goldküste (N a g tg la s ), Sklaven-
küste (Keta: P le s s in g ) , Südafrika (Lataku: Verr., Mosilikatses - Land: J. Verr.
M. S. S.), Natal (A-yres), Sambesigebiet (K irk ) , Sansibar (K e r s te n ) , Komoren
(Joanna: D ick in so n ), Madagaskar .(Verr., N ew to n ); durch Baron v. d. D e ek en
aus Ostafrika, leider ohne nähere Angabe des Fundortes, eingesandt.
Es hat den Anschein, als wenn der Rallenreiher, dessen Vorkommen dureh-
gehends als ein seltenes und vereinzeltes verzeichnet wird, in Afrika mehr oder
weniger Wintergast wäre, doch dürfte er nach einer Beobachtung E. N ew to n s,
der am 26. September auf Madagaskar ein Weibchen mit stark entwickeltem Eierstocke
erlegte, zuweilen hier auch brüten. Darauf lässt auch eine Notiz B u v ry ’s
schliessen, der am Fetzara-See in Algier den Ballenreiher im schönsten Hochzeitskleide
im Frühjahr beobachtete.
Die Lebensweise schildert N a um a n n mit bekannter Meisterschaft; Nest und
Eier beschreibt B a ld am u s (Naum. XHI. p. 258).
(367) 13. Ardea Idae, Hartl.
Ardea sp., Pelz ., Naumann. 1858. p. 497 (jun.). — A. Idae, H a rtl., Joum. f . Om. 1860. p. 167
(jun.), _ id. A. xanthopoda (Pelz.), ib. p. 166. — id. A. elegans (Verr.), xanthopoda et Idae,
Om. Fauna Madag. (1861) p. 73 et 75. — A. elegans, Roch u. Newt., IMs. 1863. p. 170. —
A. garzetta et leucoptera, Schleg., Proc. 1866. p. 425. S A. elegans, H a rtl., ib. 1867. p. 823.
—- id.' A. comata, ib. p. 827 (jun.). — A. garzetta, elegans et Idae, G r a u d id ie r , Rev. et Mag.
Zool. 1867. p. 29. No. 106, 107 et 109. — A. leucoptera, L a y a rd , B. S. Afr. p. 309. — A.
garzetta, Scbleg. u. P o ll., Rech. Faune Madag. p. 123. — id. A. leucoptera Idae, ib. p. 125.
— A. leucoptera, P e t. in litt.
Diagn. Candida; pileo et dorso ochraceo vix conspicue lavatis; plumis cer-
vicalibus nonnullis valde dongatis, latiusculis, in acumen desinentibus;
plumis juguli pendulis, lacero - decompositis; dorsi plumis decomposito-
laceris; rostro nigrescente; pedibus flavis; iride flava.
Ju n . Occipitis et juguli plumis dongatis pendulis; pilei et colli plumis
. nigris, stria mediana pallide flavida, in collo sensim' latiore maximamque
plumae partem occupante- notatis; dorso fusco, pallide flavido striato;
supracaudalibus albis; gula alba, maculis nonnullis taeniam medianam
interruptam formantibus fluscescentibus; colli lateralis et inferioris plumis
basi albis, dein flavidis, apicefusco-nigricante-marginatis; abdomine, tibiis,
subcauclalibus, alis et cauda pure albis; maxüla nigricante, mandibula
pallide comea, apicem versus nigricante; pedibus flavescente-griseis.
Long. circa 2 1 " ; rostr. 2“ 6 '" ; al. 8" 6 '" ; caud. 3 " ; tars. 2 8 '" ; dig.
med. 2 " 5 " '.
Alt. Das ganze Gefieder rein weiss, nur der Oberkopf und Hinterhals blassstrohgelb
verwaschen, noch blasser und schwächer auf dem Mantel und den langen,