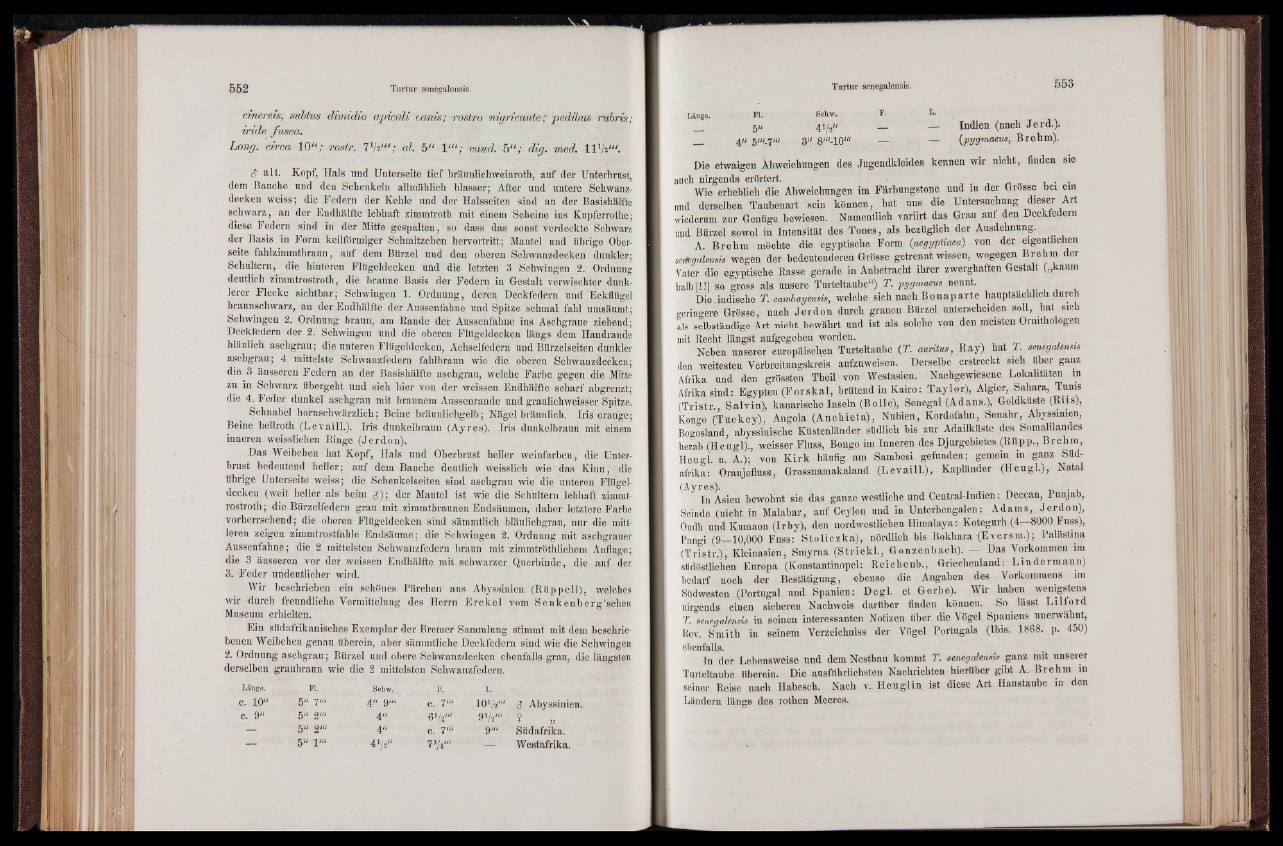
einer eis, subtus dimidio apicali canis; rostro nigricante; pedibus rubris;
iride fu s ca .
Long. circa 1 0 " ; rostr. V h " ‘; al. 5 " 1 '" ; caud. 5 " ; dig. med. l l ' h ' “.
$ a lt. Kopf, Hals und Unterseite tief bräunlichweinroth, auf der Unterbrust,
dem Bauche und den Schenkeln allmählich blasser; After und untere Schwanzdecken
weiss; die Federn der Kehle und der Halsseiten sind an der Basishälfte
schwarz, an der Endhälfte lebhaft zimmtroth mit einem Scheine ins Kupferrothe;
diese Federn sind in der Mitte gespalten, so dass das sonst verdeckte Schwarz
der Basis in Form keilförmiger Schmitzchen hervortritt; Mantel und übrige Oberseite
fahlzimmtbraun, auf dem Bürzel und den oberen Schwanzdecken dunkler;
Schultern, die hinteren Flügeldecken uftd die letzten 3 Schwingen 2. Ordnung
deutlich zimmtrostroth, die braune Basis der Federn in Gestalt verwischter dunklerer
Flecke sichtbar; Schwingen 1. Ordnung, deren Deckfedern und Eckflügel
braunschwarz, an der Endhälfte der Aussenfahne und Spitze schmal fahl umsäumt;
Schwingen 2. Ordnung braun, am Bande der Aussenfahne ins Aschgraue ziehend;
Deckfedern der 2. Schwingen und die oberen Flügeldecken längs dem Handrande
bläulich aschgrau; die unteren Flügeldecken, Achselfedern und Bürzelseiten dunkler
aschgrau; 4 mittelste Schwanzfedern fahlbraun wie die oberen Schwanzdecken;
die 3 äusseren Federn an der Basishälfte aschgrau, welche Farbe gegen die Mitte
zu in Schwarz ühergeht und sich hier von der weissen Endhälfte scharf abgrenzt;
die 4. Feder dunkel aschgrau mit braunem Aussenrande und graulichweisser Spitze.
Schnabel hornschwärzlich; Beine bräunlichgelb; Nägel bräunlich. Iris orange;
Beine hellroth (Levaill.). Iris dunkelbraun (Ayres). Iris dunkelbraun mit einem
inneren weisslichen Ringe (Je rd o n ).
Das Weibchen hat Kopf, Hals und Oberbrust heller weinfarben, die Unterbrust
bedeutend heller; auf dem Bauche deutlich weisslich wie das Kinn, die
übrige Unterseite weiss; die Schenkelseiten sind aschgrau wie die unteren Flügeldecken
(weit heller als beim <J); der Mantel ist wie die Schultern lebhaft zimmtrostroth
; die Bürzelfedern grau mit zimmtbraunen Endsäumen, daher letztere Farbe
vorherrschend; die oberen Flügeldecken sind sämmtlich bläulichgrau, nur die mittleren
zeigen zimmtrostfahle Endsäume; die Schwingen 2. Ordnung mit aschgrauer
Aussenfahne; die 2 mittelsten Schwanzfedern braun mit zimmtröthlichem Anfluge;
die 3 äusseren vor der weissen Endhälfte mit schwarzer Querbinde, die auf der
3. Feder undeutlicher wird.
Wir beschrieben ein schönes Pärchen aus Abyssinien (R ü p p e ll), welches
wir durch freundliche Vermittelung des Herrn E rc k e l vom S e n k e n b e rg ’schen
Museum erhielten.
Ein südafrikanisches Exemplar der Bremer Sammlung stimmt mit dem beschriebenen
Weibchen genau überein, aber sämmtliche Deckfedern sind wie die Schwingen
2. Ordnung aschgrau; Bürzel und obere Schwanzdecken ebenfalls grau, die längsten
derselben graubraun wie die 2 mittelsten Schwanzfedern.
Länge. Fl. Schw. . , S-jmi H n ■ 1
c. 10" 5" V“ , 4". 9"', c. V" , ' 10 .Vs"' $ Abyssinien.
c. 9" 5" 2"' 4" 6y*'" 97 •>!“ ■w m ! .
5" 2'" 4" C. 7'"' 9"' Südafrika.
— 5" IfS 4»/2" 774'" — Westafrika.
Länge. Fl. Schw. F. L.
__ g« afUSi __ — Indien (nach Je rd .).
m 3" 8"'-10'" — — (pygmaew, Brehm).
Die etwaigen Abweichungen des Jugendkleides kennen wir nicht, finden sie
auch nirgends erörtert. i, • •„
Wie erheblieh die Abweichungen im Färbungstone und in der Grosse bei em
und derselben Taubenart sein können, hat uns die Untersuchung dieser Art
wiederum zur Genüge bewiesen. Namentlich variirt das Grau auf den Decktedern
und Bürzel sowol in Intensität des Tones, als bezüglich der Ausdehnung.
A. B rehm möchte die egyptische Form (aegyptiaca) von der eigentlichen
senegalensis wegen der bedeutenderen Grösse getrennt wissen, wogegen Brehm der
Vater die egyptische Rasse gerade in Anbetracht ihrer zwerghaften Gestalt („kaum
halb [!!] so gross als unsere Turteltaube“) T. pygmaeus nennt.
Die indische T. cambayensis, welche sich nach B o n a p a r te hauptsächlich durch
geringere Grösse, nach J e rd o n durch grauen Bürzel unterscheiden soll, hat sich
als selbständige Art nicht bewährt und ist als solche von den meisten Ornithologen
mit Recht längst aufgegeben worden.
Neben unserer europäischen Turteltaube (T. auritus, Ray) hat T. senegalensis
den weitesten Verbreitungskreis aufzuweisen. Derselbe erstreckt sich Uber ganz
Afrika und den grössten Theil von Westasien. Nachgewiesene Lokalitäten m
Afrika sind: Egypten (F o r s k a l, brütend in Kairo: T ay lo r), Algier, Sahara, Tunis
(T ristr., Salvin), kanarische Inseln (Bolle), Senegal (Adans.), G-oldkiiste (Rus),
Kongo (T u ck ey ), Angola (A n ch ie ta ), Nubien, Kordofahn, Senahr, Abyssinien,
Bogosland, abyssinische Küstenländer südlich bis zur Adailktiste des Somalilandes
herab (Heugl)., weisser Fluss, Bongo im Inneren des Djurgebietes (Rüpp., B rehm,
Heugl. u. A.); von K irk häufig am Sambesi gefunden; gemein in ganz Südafrika:
Oranjefluss, Grossnamakaland (L e v a ill.), Kapländer (H eu g l.), Natal
(Avres). . .
In Asien bewohnt sie das ganze westliche und Central-Indien: Deccan, Punjab,
Scinde (nicht in Malabar, auf Ceylon und in Unterbengalen: A d ams, Je rd o n ),
Oudh und Kumaon (Irby), den nordwestlichen Himalaya: Kotegurh (4—8000 Fuss),
Pangi (9—10,000 Fuss: S to lic z k a ) , nördlich bis Bokhara (E v e rsm .); Palästina
(T ristr.), Kleinasien, Smyrna (S tric k l., Gonzenbach). — Das Vorkommen im
südöstlichen Europa (Konstantinopel: Reichenb., Griechenland: L in d e rm a n n )
bedarf noch der Bestätigung, ebenso die Angaben des Vorkommens im
Südwesten (Portugal und Spanien: Degl. et Gerbe). Wir haben wenigstens
nirgends einen sicheren Nachweis darüber finden können. So lässt L ilto rd
T. senegalensis in seinen interessanten Notizen über die Vögel Spaniens unerwähnt,
Rev. Smith in seinem Verzeichniss der Vögel Portugals (Ibis. 1868. p. 450)
ebenfalls.
In der Lebensweise und dem Nestbau kommt T. senegalensis ganz mit unserer
Turteltaube überein. Die ausführlichsten Nachrichten hierüber gibt A. B rehm in
seiner Reise nach Habesch. Nach v. H e u g lin ist diese Art Haustaube in den
Ländern längs des rothen Meeres.