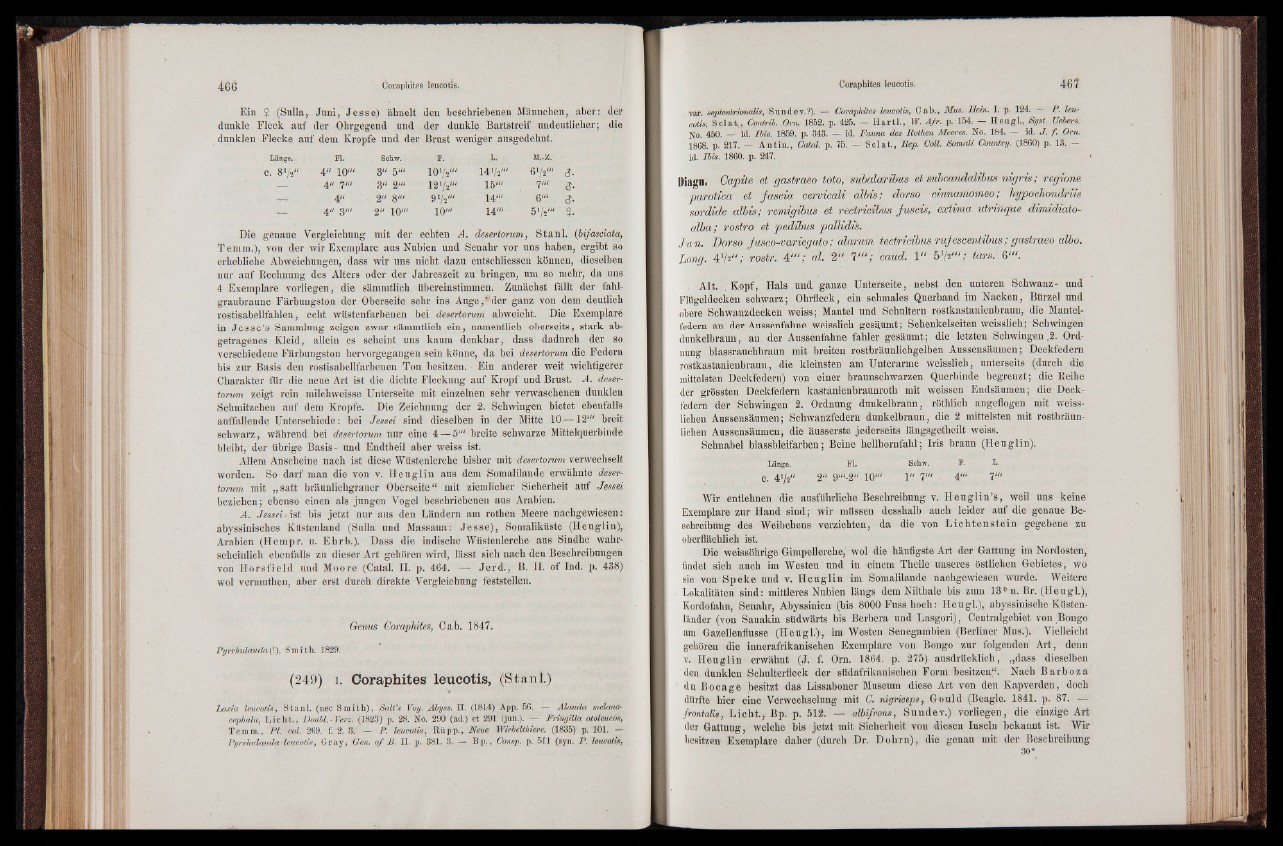
Ein $ (Sulla, Juni, J e s s e ) ähnelt den beschriebenen Männchen, aber: del'
dunkle Fleck auf der Ohrgegend und der dunkle Bartstreif undeutlicher; die
dunklen Flecke auf dem Kropfe und der Brust weniger ausgedehnt.
Länge. FL Schw. P. L. M.-Z.
c. 872" 4 " 10"' 3" 5'" IO1/*'" 1472'" 672" ' <J-
— 4/1 7/// 3 " 2'" 1272'" 15'" f j l l l 8-
M H 4"
fcO
CO
972'" 14'" 6'" 8-
— 4 " 3'" 2" 10'" 10'" 14'" ' 572'" - f .
Die genaue Vergleichung mit der echten A. desertorum, S tan l. (bifasciata,
Temm.), von der wir Exemplare aus Nubien und Senahr vor uns haben, ergibt so
erhebliche Abweichungen, dass wir uns nicht dazu entschliessen können, dieselben
nur auf Rechnung des Alters oder der Jahreszeit zu bringen, um so mehr, da uns
4 Exemplare vorliegen, die sämmtlich übereinstimmen. Zunächst fällt der fahlgraubraune
Färbungston der Oberseite sehr ins Auge,’ der ganz von dem deutlich
rostisabellfahlen, echt wüstenfarbenen bei desertorum abweicht. Die Exemplare
in J e s s e ’s Sammlung zeigen zwar sämmtlich ein, namentlich oberseits, stark abgetragenes
Kleid, allein es scheint uns kaum denkbar, dass dadurch der so
verschiedene Färbungston hervorgegangen sein könne, da bei desertorum die Federn
bis zur Basis den rostisabellfarbenen Ton besitzen. Ein anderer weit wichtigerer
Charakter für die neue Art ist die dichte Fleckung auf Kropf und Brust. A. desertorum
zeigt rein milehweisse Unterseite mit einzelnen sehr verwaschenen dunklen
Schmitzehen auf dem Kropfe. Die Zeichnung der 2. Schwingen bietet ebenfalls
auffallende Unterschiede: bei Jessei sind dieselben in der Mitte, 10 —12'" breit
schwarz, während bei desertorum nur eine 4 — 5'" breite schwarze Mittelquerbinde
bleibt, der übrige Basis- und Endtheil aber weiss ist.
Allem Anscheine nach ist diese Wüstenlerche bisher mit desertorum verwechselt
worden. So darf man die von v. H e u g lin aus dem Somalilande erwähnte desertorum
mit „satt bräunlichgrauer Oberseite“ mit ziemlicher Sicherheit auf Jessei
beziehen; ebenso einen als jungen Vogel beschriebenen aus Arabien.
A. Jessei^ist bis jetzt nur aus den Ländern am rothen Meere nachgewiesen:
abyssinisches Küstenland (Sulla und Massaua: J e s s e ), Somaliküste (Heuglin),
Arabien (Hempr. u. Ehrb.). Dass die indische Wüstenlerche aus Sindhe wahrscheinlich
ebenfalls zu dieser Art gehören wird, lässt sich nach den Beschreibungen
von H o rs fie ld und Moore (Catal. II. p. 464. — J e rd ., B. II. of Ind. p. 438)
wol vermuthen, aber erst durch direkte Vergleichung feststellen.
Genus Goraphites, Cab. 1847.
Pyrrhulaudä (!), Smith. 1829.
(249) l. Coraphites leucotis, (Stanl.)
Loxia leucotis, S tan l. (nec Sm ith ), Salt’s Voy. Abyss, ü . (18i4) App. 56. — Alauda melanö-
cephala, L ic h t., Doubl.-Verz. (1823) p. 28. No. 290 (ad.) et 291 (jun.). Fringilla otoleucos,
Temm., PI. col. 269. f. 2. 3. — P. leucotisj Rüpp., Neue Wirbelthiere. (1835) p. 101. —
Pyrrlmlauda leucotis, Gray, Gen. o f B. ü . p. 381. 3. — B p ., Consp. p. 511 (syn. P. leucotis,
var. septmtrionatis, Sund ev.?). — Coraphites leucotis, Cab., Mus. Sein. I. p. 124. — P. leucotis,
S c la t,, CtmMb. Om. 1852. p. 425. — H a r tl. , W. Afr. p. 154. — Heugl., Syst. üebers.
No. 450. — id. Uns. 1859. p. 343. — id. Fauna des Rothen Meeres. No. 184. S id. J. f. Om.
1868. p. 217. — A n tin ., Catal. p. 75. — S c la t., Rep. Coll. Somali Coumtry. (1860) p. 13. —
id. Ibis. 1860. p. 247. •
Diagn. Gapite et gastraeo toto, subalaribus et subcaudalibus nigris; regione
parotica et fascia cervicali albis; dorso cinnamomeo; hypochondriis
sordide albis; remigibus et rectricibus fuscis, extima utrinque dimidiato-
alba; rostro et pedibus pallidis.
J u n. Dorso Jusco-variegato; ala/rum tectricJbus ru fe scm tib u s; gastraeo alho.
\Long. 4 1/2/'.; rostr. 4 '“ ; a l 2 " V “ ; caud. 1“ 5 7 * '" ; tärs. 6 '" .
, Alt. Kopf, Hals und ganze Unterseite, nebst den unteren Schwanz- und
Flügeldecken schwarz; Ohrfleck, ein schmales Querband im Nacken, Bürzel und
obere Schwanzdecken weiss; Mantel und Schultern rostkastanienbraun, die Mantelfedern
an der Aussenfahne weisslich gesäumt; Schenkelseiten weisslich; Schwingen
dunkelbraun, an der Aussenfahne fahler gesäumt; die letzten Schwingen ,2. Ordnung
blassrauchbraun mit breiten rostbräunlichgelben Aussensäumen; Deckfedern
rostkastanienbraun, die kleinsten am Unterarme weisslich, unterseits (durch die
mittelsten Deckfedern) von einer braunschwarzen Querbinde begrenzt; die Reihe
der grössten Deckfedern kastanienbraunroth mit weissen Endsäumen; die Deckfedern
der Schwingen 2. Ordnung dunkelbraun, röthlich angeflogen mit weiss-
lichen Aussensäumen; Schwanzfedern dunkelbraun, die 2 mittelsten mit rostbräunlichen
Aussensäumen, die äusserste jederseits längsgetheilt weiss.
Schnabel blassbleifarben; Beine hellhornfahl; Iris braun (Heuglin).
Länge. Fl. Schw. F. L.
c. 41/2// 2" 9"'-2" 10'" 1" 7'" V 4'" 7"' .
Wir entlehnen die ausführliche Beschreibung v. H e u g lin ’s, weil uns keine
Exemplare zur Hand sind; wir müssen desshalb auch leider auf die genaue Beschreibung
des Weibchens verzichten, da die von L ie h te n s te in gegebene zu
oberflächlich ist.
Die weissöhrige Gimpellerche, wol die häufigste Art der Gattung im Nordosten,
findet sich auch im Westen und in einem Theile unseres östlichen Gebietes, wo
sie von S p ek e und v. H e u g lin im Somalilande nachgewiesen wurde. Weitere
Lokalitäten sind: mittleres Nubien längs dem Nütbale bis zum 13° n. Br. (Heugl.),
Kordofahn, Senahr, Abyssinien (bis 8000 Fuss hoch: Heugl.), abyssinische Küstenländer
(von Sauakin südwärts bis Berbera und Lasgori), Centralgebiet von Bongo
am Gazellenflusse (Heu g l.), im Westen Senegambien (Berliner Mus.). Vielleicht
gehören die innerafrikanischen Exemplare von Bongo zur folgenden Art, denn
v. H e u g lin erwähnt (J. f. Om. 1864. p. 275) ausdrücklich, „dass dieselben
den dunklen Schulterfleck der südafrikanischen Form besitzen“. Nach B a rb o z a
’ du Bo c ag e besitzt das Lissaboner Museum diese Art von den Kapverden, doch
dürfte hier eine Verwechselung lüit C. nigriceps, Gould (Beagle. 1841. p. 87.
frontalis, L ich t., Bp. p. 512. — albifrons, Sundev.) vorliegen, die einzige Art
der Gattung, welche bis jetzt mit Sicherheit von diesen Inseln bekannt ist. Wir
besitzen Exemplare daher (durch Dr. D o hm ), die genau mit der Beschreibung
30*