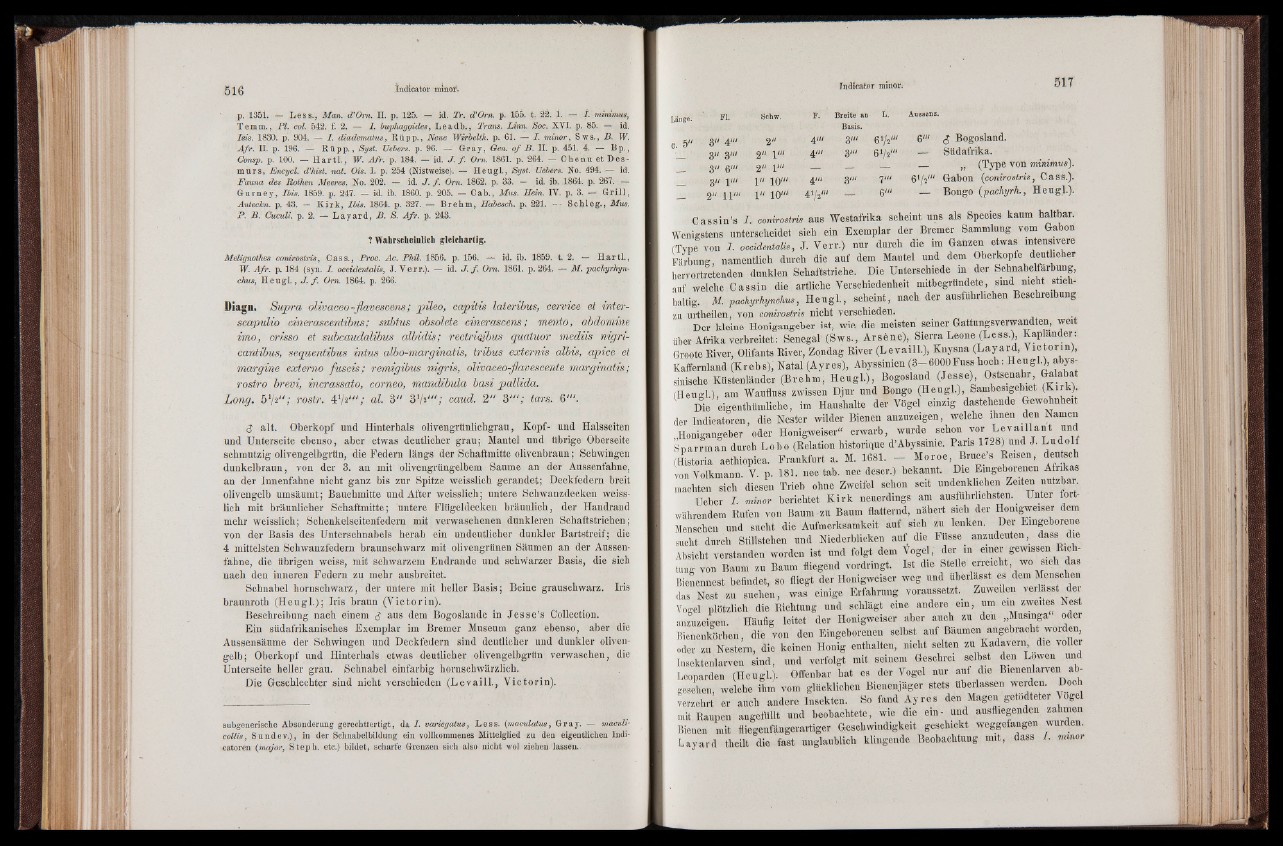
p. 135i. — L e ss., Man. d’Om. II. p. 125.'%; id. Tr. d ’Om. p. lo5. t. 22. 1. mjj&lp rninifnui,
T e m a , PI. col. 542. f. 2. — I. buphaggides, L e a d b ., Trans. IAnn. Soc. XVI. p. 85. — id.
Isis. 1830. p. 904. I. dia.dem.atus, Rüpp., Neue Wirbelth. p. 61. — I. minor, Sw s., B. W.
Afr. II. p. 196. —- R ü p p ., Syst. Hebers. p. 96. —' Gr ft y, Gen. o f B. II. p. 451. 4. — Bp.,
Ctmsp. p. 100. — H a r t l ., W. Afr. p. 184. — id. J. f . Om. 1861. p. 264. — C h e n u et Des-
m u r s , Encycl. d'hist. nat. Ois. I. p. 254 (Nistweise). — Heugl., Syst. TJebers. No. 494. — id.
Fauna des Rothen Meeres. No. 2Q2.wlpt| id. J . f . Om. 1862. p. 33. — id. ib. 1864. p. 267. —
G u rn e y , Ibis. 1859. p. 247’ - id. ib. 1860. p. 205. | | j Cab., Mus. Hein. IV. p. 3. — G r ill,
. Anteckn. p, 43. — K irk , Ibis. 1864. p. 327. — B rebm , Habeseh. p. 221. — Sch leg ., Mus.
P. B. Oueuli. p. 2. — L a y a rd , B. S. Afr. p. 243.
? Wahrscheinlich gleichartig.
Melignothes conirostris, Cass., Proc. Ac. Phil. 1856. p. 156. — id. ib. 1859. t, 2. H a r tl.,
W. Afr. p. 184 (syn. I. ocddentalis, J. Yerr.). — id. J . f Om. 1861. p. 264. — M. pachyrhyn-
chus, H e u g l., J . f . Om. 1864. p. 266.
Diagn. Su p ra olivaceo~ßavescens; p ileo, capitis lateribus, cervice et inter-
scapulio dnerascentibus; rnbtus obsolete cinerascens; mento, abdomine
imo, crisso et subcaudalibus albidis; rectnoibus quatuor mediis nigri-
cantibus, sequentibus intus albo-marginatis, tribus extemis albis, apice et
margine extemo fu s c is ; remigibus nigris, olivaceo-flavescente marginatis;
rostro brevi, incrassato, comeo, mandibula basi pallida.
Long. ; rostr. 472" '; al. 3 " 3 'h ‘“ ; caud. 2 " 3 '" ; tars. 6 " '.
3 alt. Oberkopf und Hinterhals olivengrünliehgrau, Kopf- und Halsseiten
und Unterseite ebenso, aber etwas deutlicher grau; Mantel und übrige Oberseite
schmutzig olivengelbgrün, die Federn längs der Sehaftmitte olivenbraun; Schwingen
dunkelbraun, von der 3. an mit olivengrüngelbem Saume an der Aussenfahne,
an der Innenfahne nicht ganz bis zur Spitze weisslich gerandet; Deckfedern breit
olivengelb umsäumt; Bauchmitte und After weisslich; untere Schwanzdecken weisslieh
mit bräunlicher Sehaftmitte; untere Flügeldecken bräunlich, der Handrand
mehr weisslich; Schenkelseitenfedern mit verwaschenen dunkleren Schaftstrichen;
von der Basis des Unterschnabels herab ein undeutlicher dunkler Bartstreif; die
4 mittelsten Schwanzfedern braunschwarz mit olivengrünen Säumen an der Aussenfahne,
die übrigen weiss, mit schwarzem Endrande und schwarzer Basis, die sich
nach den inneren Federn zu mehr ausbreitet.
Schnabel hornschwarz, der untere mit heller Basis; Beine grauschwarz. Iris
braunroth (H eu g l.); Iris braun (V ic to rin ).
Beschreibung nach einem 3 aus dem Bogoslande in J e s s e ’s Collection.
Ein südafrikanisches Exemplar im Bremer Museum ganz ebenso, aber die
Aussensäume der Schwingen und Deckfedern sind deutlicher und dunkler olivengelb;
Oberkopf und Hinterhals etwas deutlicher olivengelbgrün verwaschen, die
Unterseite heller grau. Schnabel einfarbig hornschwärzlich.
Die Geschlechter sind nicht verschieden (L e v a ill., Victorin).
subgenerische Absonderung gerechtlertigt, da I. variegatus, L e ss . (maculatus, Gray. — mäculi-
collis, S undev.), in der Schnabelbildung ein vollkommenes Mittelglied zu den eigentlichen Indi-
catoren (major, S tep h . etc.) bildet, scharfe Grenzen sich also nicht wol ziehen lassen.
Länge. » Schw- F' Br8ite a° L' A”3äaIlz'
Basis.
c 5" 3" ¿.in 2" 4“ 3'" 6V2"' 6"' 3 Bogosland.
3» 3'" 2" 1 “■ 4'" 3'" ßfflH — Südafrika.
3« 6"' 2" 1'" — — — 9 « (Typevon minimus).
an m io “'c ' 4 37» V“ Gabon (conirostns, Cass.).
2“ 11"' 1" 10"' 472'" — 6'" B°nS° (pabhyrh., Heugl.).
C a s s in ’s I . conirostns aus Westafrika scheint uns als Species kaum haltbar.
Wenigstens unterscheidet sich ein Exemplar der Bremer Sammlung vom Gabon
(Type von I. ocddentalis, J. Verr.) nur durch die im Ganzen etwas intensivere
Färbung, namentlich durch die auf dem Mantel und dem Oberkopfe deutlicher
hervortretenden dunklen Schaftstriche. Die Unterschiede m der Schnabelfarbung,
auf welche C a s s in die artliche Verschiedenheit mitbegründete, sind nicht stichhaltig.
M. pachyrhynchus, H eu g l., scheint, nach der ausführlichen Beschreibung
ZU, urtheilen, von conirostris nicht verschieden.
Der kleine Honigangeber ist, wie die meisten seiner Gattungsverwandten, weit
über Afrika verbreitet: Senegal (Sws., Arsèn e ), Sierra Leone (Less.), Kaplander:
Groote River, Olifants River, Zondag River (Levaill.), Knysna (L a y a rd , V ic to rin ),
Kaffernland (Krebs),' Natal (Ayres), Abyssinien (3 -6 0 0 0 Fuss hoch: Heugl.), abys-
sinische Küstenländer (Brehm, H eu g l.), Bogosland (Jesse), Ostsenahr Galabat
(Heugl), am Waufluss zwissen Djur und Bongo (Heugl.), Sambesigebiet (Kirk).
Die eigenthümliche, im Haushalte der Vögel einzig dastehende Gewohnheit
der Indicatoren, die Nester wilder Bienen anzuzeigen, welche ihnen den Namen
„Honigangeber oder Honigweiser“ erwarb, wurde schon vor L e v a il la n t und
S p a rrm an durch Lobo (Relation historique d’Abyssime. Paris 1728) und J. L u d o lf
llistoria aethiopica. Frankfurt a, M. 1681. - Moroc, Bruce’s Reisen, deutsch
von Volkmann V. p. 181. nec tab. nec descr.) bekannt. Die Eingeborenen Afrikas
machten sich diesen Trieb ohne Zweifel schon seit undenklichen Zeiten nutzbar
Ueber I , minor berichtet K irk neuerdings am ausführlichsten. Unter fortwährendem
Rufen von Baum zu Baum flatternd, nähert sich der Honigweiser dem
Menschen und sucht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der Eingeborene
sucht durch Stillstehen und Niederblicken auf die Füsse anzudeuten, dass die
Absicht verstanden worden ist und folgt dem Ÿogel, der in einer gewissen Richtung
von Baum zu Baum fliegend vordringt. Ist die Stelle erreicht , wo sich das
Bienennest befindet, so fliegt der Honigweiser weg und überlasst es dem Menschen
das Nest zu suchen, was einige Erfahrung voraussetzt. Zuweilen verlasst der
Vogel plötzlich die Richtung und schlägt eine andere ein, um em zweites Nest
anzuzeigen. Häufig leitet der Honigweiser aber auch zu den „Musinga oder
Bienenkörben, die von den Eingeborenen selbst auf Bäumen angebracht worden,
oder zu Nestern, die keinen Honig enthalten, nicht selten zu Kadavern die voller
Insektenlarven sind, und verfolgt mit seinem Geschrei selbst den Löwen und
Leoparden (Heugl.). Offenbar hat es der Vogel nur auf die Bienenlaiven abgesehen,
welche ihm vom glücklichen Bienenjäger stets überlassen werden. Doch
verzehrt er auch andere Insekten. So fand A y re s den Magen getodteter Vogel
mit Raupen angefüllt und beobachtete, wie die em- und ausfliegenden zahmen
Bienen mit fliegenfängerartiger Geschwindigkeit geschickt weggefangen wurden.
L a y a rd theilt die fast unglaublich klingende Beobachtung mit, dass I. minor