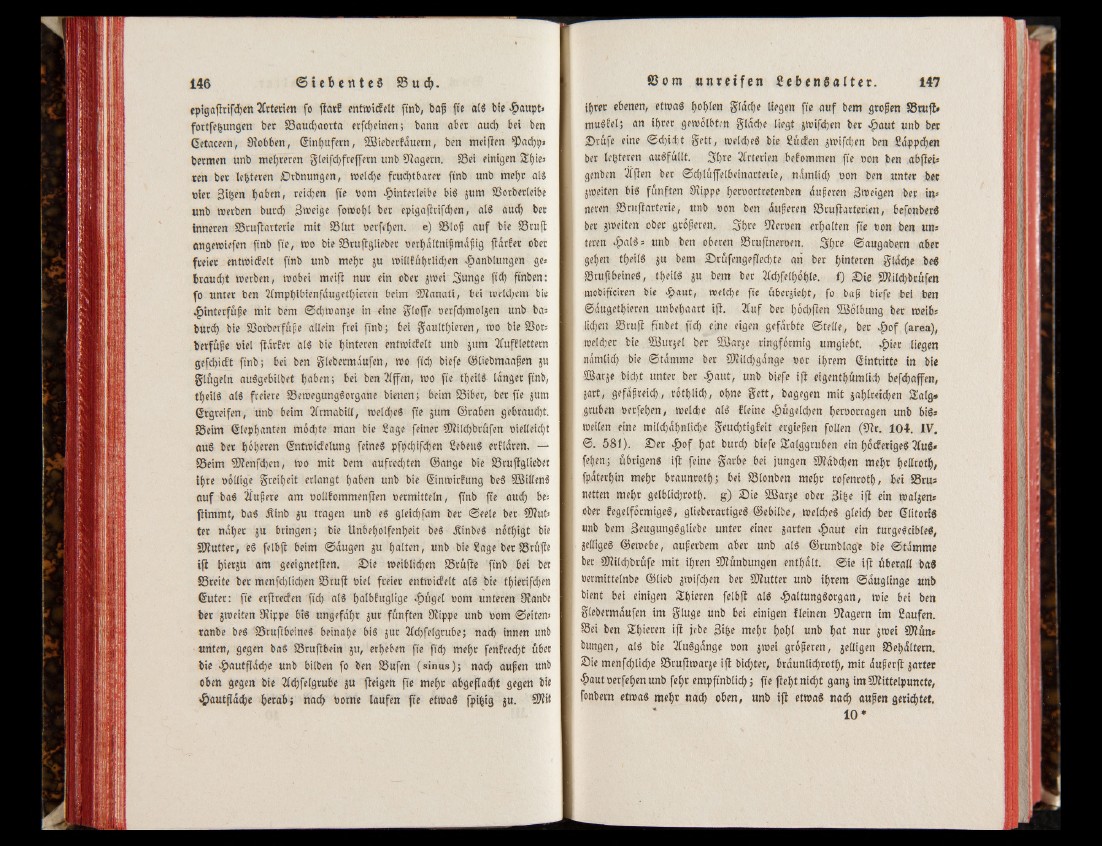
epigaflrifdben Tfrterien fo flarf enfwidelt ftnb, baß fte als bte $aupts
fortfe|ungen bet SSaudjaorta erfebeinen; bann abet aud) bei ben
©etaceen, Slobben, ©inbufern, Söiebetkauetn, ben meinen ^)ad)p»
betmen wnb mehreren gteifebfreffern unb la g e rn . SSei einigen St)iej
ren bet leiteten £>rbnungen, welche fruchtbarer ftnb unb mehr als
t>iet Bibon bflhen, reichen fte vom ^interleibe bis jum ©orbetleibe
unb werben butd) Bwdge fowobl bet epigaßrifeben, als aud) bet
inneren SSruflarterie mit SSlut verfemen. e) SSloß auf bie SStuß
angewiefen ftnb fte, wo bie S3tußgliebet verbdltnißmdßig fldtfet ober
freiet entwickelt ftnb unb mebt ju willfubtlicben ^tanblungen ge»
braudjt werben, wobei meift nur ein obet jwei Sfunge fid) ftnben:
fo unter ben 2fmpbibienfdugetbieren beim SJlanati, bei welchem bie
Hinterfüße mit bem ©djwanje in eine Stoffe verfcbmoljen unb bas
butd) bie SSorberfüße allein frei ftnb; bei gaultbieren, wo bie Bor*
berfufje viel fldrker als bie hinteren entwidelt unb jttm 2fufklettern
gefd)idt ftnb; bei ben glebermaufen, wo ftd) biefe ©liebmaaßen ju
glügeln auSgebitbet haben; bei ben Riffen, wo fte tbeilS langet ftnb,
tbeitS als freiere SSewegungSorgane bienen; beim S5iber, bet fte jum
(Ergreifen, unb beim 2frmabill, welches fte gum ©raben gebraucht.
SSeim ©lepbanten mochte man bie Sage feinet fDlilcbbrüfen vielleicht
auS bet bohlen ©ntwidelung feines pft)d)ifcben SebenS erklären.:—
SSeim SSlenfcben, wo mit bem aufrechten ©ange bie SSruflglieber
ihre völlige greibeit erlangt haben unb bie ©inwirkung beS SBillenS
auf baS äußere am vollkommenßen vermitteln, ftnb fte aud) U-
flimmt, baS Äinb ju tragen unb eS gleicbfam bet ©eele bet S0?ut*
tet nabet ju bringen; bie Unbebolfenbeit beS ÄinbeS ndfb'tgt bie
SJlutter, eS felbft beim ©äugen ju beiten, unb bie Sage bet SSrüße
iß biet$u am geeignetßen. Die weiblichen SSrüße ftnb bei bet
SSreite bet menfd)lid)en SSruß viel freier entwickelt als bie fbierifeben
©uter: fte etßreden ftcb als balbkuglige Hügel vom unteren Slanbe
bet jweiten SJippe bis ungefähr ju t fünften Stippe unb Vom ©eitern
ranbe beS SStußbeineS beinahe bis jur 2kd)fe(grube; nach innen unb
unten, gegen baS SSrußbein jtt, erbeben fte ftd) mehr fenkredßt übet
bie Hautßacbe unb bilben fo ben SSufen (sin u s); nad) außen unb
oben gegen bie 2fcbfelgrube ju ßeigen fte mebt abgeßadßt gegen bie
#autfldcbe herab; nach vorne laufen fte etwas fpifcig ju. fflit
ihrer ebenen, etwas bohlen gtacbe liegen fte auf bem großen SStufi»
muSfet; an ihrer gewölbten gladbe liegt jwifdjen ber H aut unb bet
Drüfe eine ©d)id)t g e tt, weldjeS bie Süden jwifeben ben Süppchen
ber lederen ausfüllt. Sh^e Arterien bekommen fte von ben abßei*
genben 2lßen ber ©d)lüffelbeinarterie, ndmlid) von ben unter bet
jtveiten bis fünften Stippe betvortretenben dußeren Bweigen bet in*
neren SSruflarterie, unb von ben dußeren SSrußarterien, befonberS
ber ^weiten ober größeren. 3 bte Sterven erhalten fte von ben uns
teren ^>alS= unb ben oberen S3rußnerven. 3bre ©augabern abet
gehen tbeilS ju bem Drüfengeßed)te an ber hinteren gtdebe beS
S3tußbeineS, tbeilS $u bem bet 2ld)felb6hle. f) S ie JStilcbbrüfen
mobifteiren bie H au t, welche fte überlebt, fo baß biefe bei ben
Saugetieren unbehaart ißt. 2fuf ber bbd)ßen Söblbung bet weibs
liehen S3rujl ftnbet ftd) eine eigen gefärbte ©teile, ber H of (area),
tveldjer bie Süurjel ber 2öar$e ringförmig umgtebt. Hier liegen
ndmlicb bie ©tdmme ber 9J?ild)gdnge vor ihrem ©intritte in bie
Söarje bid)t unter ber H au t, unb biefe ißt eigentümlich befebaffen,
gart, gefäßreich, rotblid), ohne g ett, bagegen mit iablreicben Saig»
gruben vetfeben, welche als kleine ^jügelcben b^rvorragen unb bis*
weiten eine mildjdbnticfje geud)tigkeit ergießen füllen (Str. 104. IV.
@. 581). Dev £ o f b<d butd) biefe Saiggruben ein boderigeS 2fuS*
feben; übrigens ifl feine garbe bei jungen 9Jtdbd)en mehr hellrot*),
fpdterhin mehr braunrotb; bei 33lonben mehr rofenrotb, bei S3rus
netten mehr gelblicbrotb. g) Die 2Barje ober B i|e ifl ein walken*
ober kegelförmiges, gtieberartigeS ©ebilbe, welches gleich bet ©litoriS
unb bem BeugungSgltebe unter einet jarten $ a u t ein turgeSdbleS,
jelligeS ©ewebe, außerbem abet unb als ©runbtagt bie ©tdmme
ber SJtilcbbrüfe mit ihren SStünbungen enthalt, ©ie iß: überall baS
Vermittelnbe ©lieb gwifcfjen bet SJlutter unb ihrem ©duglinge unb
bient bei einigen Sbieren felbfl als ^altungSorgan, wie bei ben
glebermaufen im gtuge unb bei einigen kleinen SJagern im Saufen.
83ei ben Shieren ifl jebe Bi^e mehr bohl unb bat nur jwei 5Wün*
bungen, als bie 3fuSgdnge von jwei größeren, ^eiligen SSebaltern.
Die menfd)lid)e S5rußwar$e ifl bichter, brdunlicbrotb, mit dußerfl gartet
«^autverfebenunb febr empftnblicf); fte fleht nicht ganj im fSlittelpuncte,
fonbern etwas mehr nach oben, unb ifl etwas nach außen gerichtet.
* 1 0 *