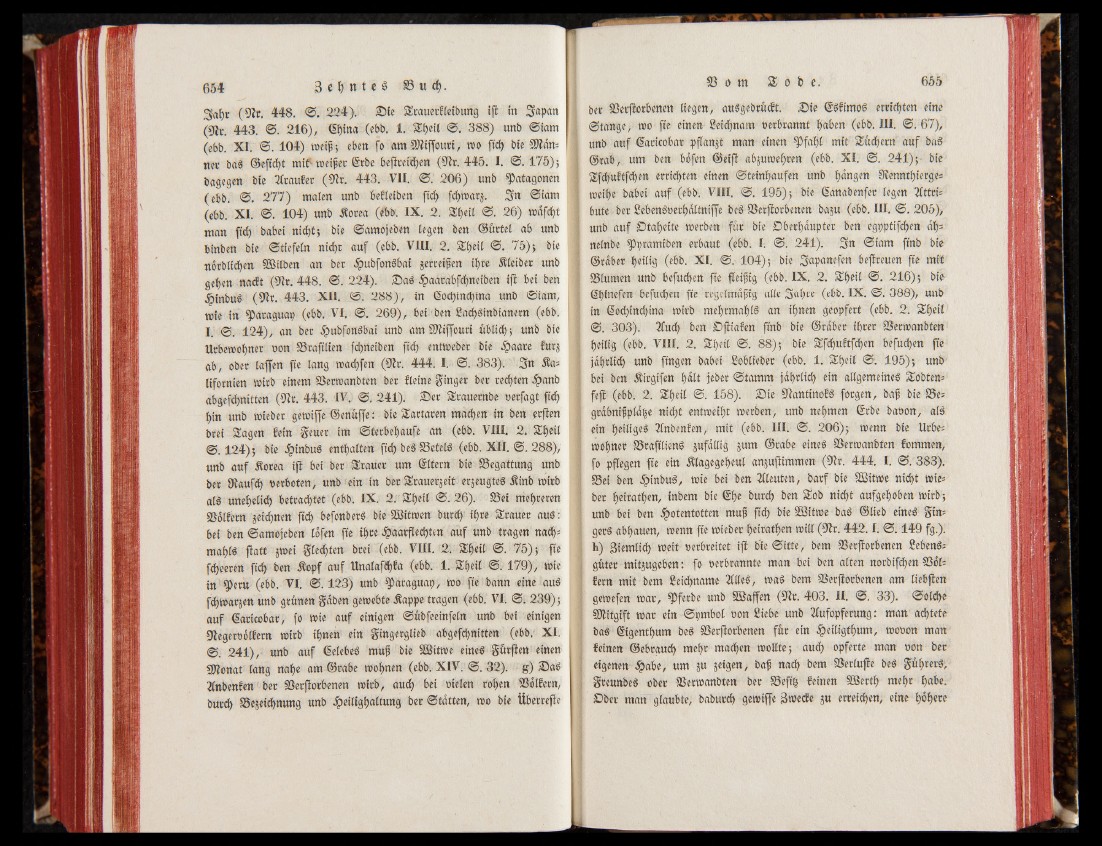
(9 lr. 44 8 . © . 2 2 4 ). S ie Scauerfleibmtg ißt in Sapan
(9?r. 44 3 . 2 1 6 ), dhfna (ebb. 1. Sheil © . 38 8 ) unb ©tarn
(ebb. X I. © . 104) weif*, eben fo am Sttiffouri, wo ftd> bie 3ttan=
nee baS ©eftdht mit'weißer dtbe beficeietjen (fftr. 445. I. © . 17 5 );
bagegen bie Krauler (9ic. 443. VII. © .’ 2 0 6 ) unb g>atagonen
(ebb. © . 2 7 7 ) malen unb beileibe« fiel) fdjwarj. 3 « ©tarn
(ebb. X I. © . 104) unb Äotea (fbk IX . 2. Sf)eil © . 2 6 ) wdfd)t
man ftrf) babei nicht; bie ©amojeben legen ben ©ürtel ab unb
binben bie ©tiefeln nicht auf (ebb. V III, 2. Sheil © . 7 5 ); bie
nbcblidjen SBitben an bet .^ubfonSbai setteißen ihre Äleibet unb
gelten naeft (9lt. 44 8 . © . 224). ©aS ^paaedbfe^netben ißt bei ben
$inbu$ (Sfic. 443. X II. © . 2 8 8 ) , in docfyinchitta unb ©tarn,
wie in fparaguap (ebb. VI. © , 2 6 9 ), bei: ben SachSinbianetn (ebb.
I. © . 1 2 4 ), an bec .ipubfonSbai unb amSftiffouti üblich; unb bie
Urbewohner non SSraftlien feßneiben fiel) entweber bie $ a are furj
ab, ober taffen fte lang w arfen (jftt. 44 4 . I, © . 383). 7 3 « Ä =
lifornien wirb einem SSerwanbten ber Heine Singer ber rechten # an b
abgefdjnitten (Dir. 443. IV. © . 241), © er Srauetnbe »erfagt ftch
hin unb wiebec gewiffe ©enüffe: bie Sartaren machen in ben erften
brei Sagen fein geuer im ©terbehaufe an (ebb. VIII. 2 . Sheil
© . 1 2 4 ); bie dpinbuS enthalten ftch beS SSetelS (ebb. X II. © . 288),
unb auf Äorea iffc bei ber S tau er um Eltern bie Begattung unb
ber Staufch «erboten, unb ein in ber Srauerjeit erzeugtes Äinb wirb
als unehelich betrautet (ebb. IX . 2: Sf)eil © .2 6 ). S3ei mehreren
SSolfem jeichnen ft<h befonbetS bie Sßitwen butch ihre S tau er auS:
bei ben ©amojeben lofen fte ihre Haarflechten auf unb tragen na<h=
mahl« ffcatt jwei S tedten brei (ebb. VIII. 2. Sheil © . 7 5 ); fte
fcheeren ftch ben Äopf auf Unalafißfa (ebb. 1. Sheil © . 1 7 9 ), wie
in ^ e tu (ebb. VI. © .1 2 3 ) unb ^arag u ap , wo fte bann eine auS
fchWarjen unb grünen gaben gewebte Äappe tragen (ebb. VI. © . 2 3 9 );
auf daricobar, fo wie auf einigen ©übfeemfeln unb bei einigen
9fleget»6lfetn wirb ihnen ein gingetglieb abgefchnitten (ebb. X I.
© . 2 4 1 ),- unb auf delebeS muß bie SBitwe eines gürfien einen
Sflonat lang nahe am © tabe wohnen (ebb, X IV . © . 32). g) ©aS
Anbenfen ber SSerjtorbenen wirb, auch bei fielen rohen SSblfetn,
burch SSejeicßnung unb Jpeitighattung ber ©tdtten, wo bie Überreife
bec SSerßtorbenen liegen, auSgebrücft. ©ie dSfimoS errichten eine
@tange> wo fte einen Seidßnam »erbrannt haben (ebb. III. © .6 7 ),
| unb auf daricobar pflanjt man einen fpfaßl mit Sücßern auf baS
© rab, um ben bofen ©etffc abjuweßten (ebb. X I. ©. 2 4 1 ); bie
Sfcßuftfcßen errichten einen ©teinhaufen unb hangen £Fvennthierge=
weihe babei auf (ebb. VIII. © . 1 9 5 ); bie danabenfer legen Attrfe
| bute ber SebenSoerhdltniffe beS SSerßtorbenen baju (ebb. III. © . 2 0 5 ),
I unb auf ©taßeite werben für bie ©berhdupter ben egpptifchen dßs
I nelnbe fpptanttben erbaut (ebb. I. © . 241). S n ©tarn ftnb bie
I ©rdber heilig (ebb. X I. © . 1 0 4 ); bie Sapattefen betreuen fte mit
I SSlumen unb befueßen fte fleißig (ebb. IX . 2. Sheil © . 2 1 6 ); bie-
I dßinefen befubhen fte regelmäßig alle Soßre (ebb. IX . © . 388), unb
I in dodhineßina wirb mehratahts an ihnen geopfert (ebb. 2. Sheil
I © . 303). Aud) bert ©ftiafen ftnb bie ©rabec ihrer SSerwanbten
! ßetlig '(ebb. VIII. 2. Sheil © . 88); bie Sfchuftfchen befuchen fte
jährlich unb fingen babei Soblieber (ebb. 11 Sheil © . 1 9 5 ); unb
bei ben Äirgifen hdlt jeber ©tam m jährlich ein allgemeines Sohlen;
feft (ebb. 2. Sheil ©. 158). ©ie jJiattttnofS forgen, baß bie 25e=
gtdbnißplaße nicht entweiht werben, unb nehmen drbe ba»on, als
ein heiliges Anbenfen, mit (ebb. III. © . 2 0 6 ); wenn bte Urbe;
wohnet SSraftltenS jufdllig jum ©rabe eines SSerwanbfen fommen,
fo pflegen fte ein Älagegeßeut anjuftimmen (9ir. 44 4 . I. © . 383).
SSei ben JpinbuS, wie bei ben bleuten, barf bie SBitwe nicht wies
ber heiraten , tnbent bie dße burdß ben Sob nicht aufgehoben wirb;
unb bei ben Sbotentotten muß ftch &te SBttwe baS ©lieb eines gi«;
gerS abhauen, wenn fte wiebec heiratßen will (9?r. 4 4 2 .1. © . 149 fg.).
h) giemlidh weit »erbreitet ift bte © itte, bem SSetfbrbenen 2ebenS=
guter mit$ugeben: fo »erbrannte man bei ben alten norbifchen 9361=
fern mit bem Seidhname 2tlleS, waS bem SSerftorbenen am liebften
gewefen w ar, ^)ferbe unb SBaffen (9ir. 403. II. © . 33). ©oldhe
M itgift war ein ©pmbol »on Siebe unb Aufopferung: man adhtete
I baS digenthum beS SSerftorbenen für ein $eiligtbum , wooon man
| feinen ©ebrgudh mehr machen wollte; auch opferte man »on ber
* eigenen dpabe, um ju geigen, baß nach bem SSerlufte beS gührerS,
| greunbeS ober SSerwanbten ber SSeftfc feinen SOBecth mehr h ^ e .
[ ©ber man glaubte, babutef) gewiffe Bwecfe ju erreidhen, eine höhere