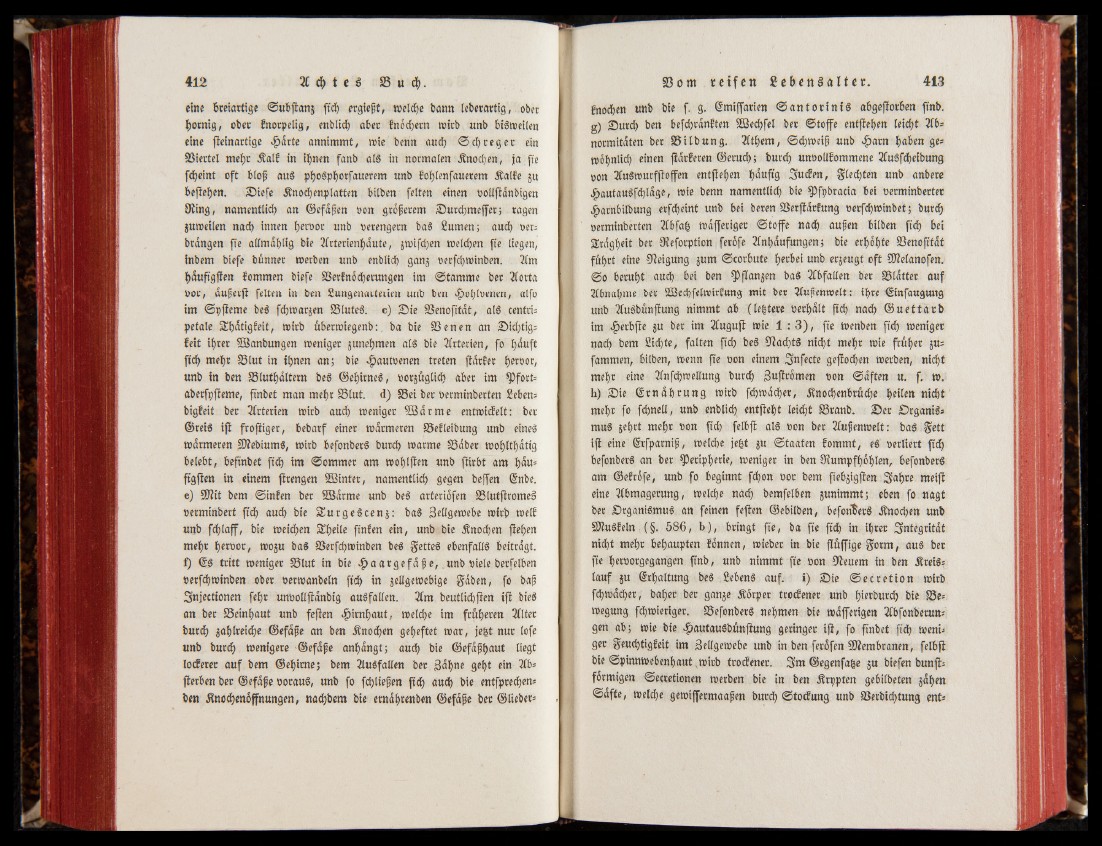
eine bretaettge ©ubjkanj ftdf> ergieft, welche bann leberartig, ober
hornig, ober knorpelig, enblich aber knöchern wirb unb bisweilen
eine jleinartige $ d rte annimmt, wie benn and) ©c h t e g e r ein
Sßiertel mehr Äalk in ihnen fanb als in normalen Änochen, ja fte
fdheint oft blof auS phoSphorfauerem unb kohlenfauetem Äalke jit
befielen, Siefe Änochenptatten bilben feiten einen vollftdnbigen
9üng, namentlich an ©efdfen von grbferem Surchmeffer; tagen
juweilen nach innen hervor unb verengern baS Surnen; audh ver=
btdngen ft'e atlmahlig bie Arterienhaute, jwifchen welchen fie liegen,
inbem biefe bünner werben unb enblich ganj verfchwinben. Am
hauftgffen kommen biefe S3erknocherungen im ©tamme bet Aorta
vor, dufetfi feiten in ben Sungenarterien unb ben $ol)lt>enen, alfo
im ©pffente beS fchwarjen SSluteS. c) S ie SSenofftdt, als centri=
petalc Shdtigfeit, wirb übetwiegenb:. ba bie SSenen an Sichtig*
feit ihrer Söanbungen weniger junehmen als bie Arterien, fo hduft
ftdh mehr SSlut in ihnen an; bie .fjautvenen treten ftarker f)ecv»or,
unb in ben SSlutfjdltern beS ©ehirneS, vorjüglicf) aber im Pfort*
aberfpfieme, ftnbet man mehr SSlut. d) SSei ber verminberten Sehen*
bigfeit ber Arterien wirb auch weniger SBa rme entwickelt: ber
©reis iji frojtiger, bebarf einer wärmeren SSefleibung unb eines
wärmeren SflebiumS, wirb befonberS but<h warme SSdber wohlthdtig
belebt, beftnbet ftdh int ©ommer am wohljken unb jiirbt am hdu*
ftgjien in einem ftrengen SBinter, namentlich gegen beffen (Snbe.
e) £0?it bem ©inken ber SBdrrne unb beS arteridfen SStutjtromeS
verminbert ftdh auch bie &u r g e S c e n $ : baS Zellgewebe wirb weif
unb fdf?laff, bie weichen SEheile finken ein, unb bie Knochen flehen
mehr hervor, woju baS SSerfchwinben beS SetteS ebenfalls beitragt.
f) @S tritt weniger SSlut in bie » f j a a r g e f d f e, „unb viele berfelben
verfchwinben ober verwanbeln ftdh in jellgewebige Sdben, fo baf
Snjectionen fehr unvolljtdnbig auSfallen. Am beutlidhfien ifl bieS
an bet SSeinhaut unb fejien Hirnhaut, welche im früheren 2Clter
burdh jahlreiche ©efdfe an ben Änodhen geheftet w ar, je |t nur lofe
unb burdh wenigere ©efafe anhangt; audh biß ©efdfhaut liegt
loderet auf bem ©ehirne; bem Ausfallen ber Zdhne geht etn 2Cbs
fterben ber ©efdfe voraus, unb fo fcfjliefen ftdh audh bie entfprechen*
ben Änochenoffnungen, nachbem bie ernahtenben ©efdfe ber ©lieber*
fnodhen unb bie f. g. (Smiffarien © a n t o r i n i S abgefforben ftnb.
g) Surdh ben befdhranften Söedhfel ber ©toffe entfiehen leicht Ab*
normitaten bet SS Üb u n g . Athem, ©dhweif unb $ a rn hoben ge*
wohnlich «inen fidtferen ©erudh; burch unvollfommene AuSfchetbung
von AuSwurfjkoffen entfiehen hduftg Sucken, Siechten unb anbere
«öautauSfcblage, wie benn namentlich bie Pfpbracia bei verminbertec
$atnbilbung erfcheint unb bei beren SSerfidrfung verfdhwinbet; burdh
verminberten Abfafc wdfferiger ©toffe nadh aufen bilben ftdh bei
SErdgheit ber 9feforption ferofe Anhäufungen; bie erhöhte SSenofttdt
fährt eine Neigung $um ©corbute herbei unb erzeugt oft Pielanofen.
@o beruht audh bei ben Pflanzen baS Abfallen ber SSldtter auf
Abnahme ber SBecffelwirkung mit ber Aufenwelt: ihre (Sinfaugung
unb AuSbünfhtng nimmt ab (le|tere verhalt ftdh nadh © u e t t a r b
im $etbjfe ju ber im Augufi wie 1 : 3 ) , ft'e wenben ftdh weniger
nadh bem Sichte, falten ftdh beS Nachts nicht mehr wie früher §«*
fammen, bilben, wenn fte von einem Snfecte gefiochen werben, nicht
mehr eine Anfdhwellung burdh Zufitdmen von ©dften u. f. w.
h) S ie ( S r n d h r u n g wirb fchwadher, Änodhenbrüche heilen nicht
mehr fo fchnell, unb enblich entjteht leicht SSranb. S e r SrganiS*
muS jehrt mehr von ftdh felbft als von ber Aufenwelt: baS Sett
ift eine (Srfparnif, welche je |t ju © taaten kommt, eS verliert ftdh
befonberS an ber Peripherie, weniger in ben Siumpfhohlen, befonberS
am ©ekrofe, unb fo beginnt fchon vor bem ftebjigfien Söhre nteifi
eine Abmagerung, welche nach bemfelben junimmt; eben fo nagt
ber SrganiSmuS an feinen feften ©ebilben, befonberS Änochen unb
PhtSkeln (§. 5 8 6 , b ) , bringt fte, ba fte ftdh rn ihrer Sntegritdt
nicht mehr behaupten können, wieber in bie flüffige S orm , auS ber
fte hervorgegangen ftnb, unb nimmt fte von Steuern in ben ÄreiS*
lauf $u Erhaltung beS SebenS auf. i) S ie © e c r e t i o n wirb
fhwadher, bähet ber ganje Äorpet trockener unb hierburdh bie SSe*.
wegung fdhwieriger. SSefonberS nehmen bie wdfferigen Abfonberun*
gen ab; wie bie ^autauSbünfiung geringer ijt, fo ftnbet ftdh weni*
ger Feuchtigkeit im Zellgewebe unb in ben ferofen Membranen, felbji
bie ©pinnwebenhaut 4wirb trockener. Sm ©egenfage ju biefen bunjt*
förmigen ©ecretionen werben bie in ben Ärppten gebilbeten jähen
©dfte, welche gewiffermaafen burdh ©todkung unb SSerbichtung ent*